
Am 25. Januar 2018 wurde der Strafprozess gegen Ralf S. vor der 1. Großen Strafkammer des Landgerichts Düsseldorf eröffnet. Der Vorwurf: versuchter Mord in zwölf Fällen durch Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion. Fast ein Jahr zuvor – am 31. Januar 2017 – war S. nach zweieinhalbjährigen, abseits der öffentlichen Wahrnehmung wieder aufgenommenen Ermittlungen in U-Haft genommen worden. Für die Ermittlungs- und Anklagebehörden und auch in großen Teilen der medialen Öffentlichkeit galt der Wehrhahn-Anschlag nun als endlich aufgeklärt und die Verurteilung des Beschuldigten auf Grundlage einer angeblich geschlossenen und keinerlei Zweifel an der Täterschaft aufweisenden „Indizienkette“ als reine Formsache. Es kam anders: Ralf S. wurde im Laufe des Prozesses aus der Haft entlassen, da nach Beschluss der Kammer vom 17. Mai 2018 „kein dringender Tatverdacht mehr“ bestehe. Am 31. Juli 2018 folgte nach 34 Prozesstagen das Urteil, nachdem zuvor die Staatsanwaltschaft, die Anwält*innen der fünf Nebenkläger*innen und die dreiköpfige Verteidigung ihre Plädoyers gehalten hatten: Freispruch. Die „Indizienbeweise“ würden „auch in der Summe nicht ausreichen, um die Täterschaft des Angeklagten zweifelsfrei nachzuweisen“. Die Staatsanwaltschaft legte Revision ein, die mit Urteil vom 14. Januar 2021 vom Bundesgerichtshof verworfen wurde. Damit war das Urteil rechtskräftig – und Ralf S. für die U-Haft und Durchsuchungen zu entschädigen.
Am 1. Februar 2017, am Tag nach der Festnahme von Ralf S., luden die Düsseldorfer Polizei und Staatsanwaltschaft zu einer Pressekonferenz ins Polizeipräsidium ein. Man habe „die Opfer [des Wehrhahn-Anschlags] nie vergessen und auch nie aufgehört, nach dem Täter zu suchen“, behauptete der Düsseldorfer Polizeipräsident Norbert Wesseler. Der Anschlag sei nun aufgeklärt, der Täter im Gefängnis. Oberstaatsanwalt Ralf Herrenbrück wies darauf hin, dass die Ermittlungen noch keineswegs abgeschlossen seien. Man habe, nachdem klar gewesen sei, dass „die Beweislage für einen Haftbefehl ausreicht, weitere Ermittlungen zurückgestellt“, um zu vermeiden, dass z.B. durch die Vernehmung von Zeug*innen Informationen zum Ermittlungsstand nach außen bzw. zum Beschuldigten dringen. Unerwähnt ließ Herrenbrück hierbei, dass S. seit Oktober 2016 wusste, dass erneut gegen ihn ermittelt wurde. Einer der von den Ermittler*innen befragten Zeugen hatte S. darüber informiert. Ebenso unerwähnt blieb, dass die Ermittlungen gegen S. ohnehin wenige Tage nach der Festnahme in den Sitzungen des Ende 2014 vom NRW-Landtag eingesetzten Parlamentarischen Untersuchungsausschusses (PUA) zum NSU-Komplex zur Sprache gekommen wären. Der PUA hatte in interner Absprache mit den Ermittlungsbehörden die Behandlung des Themas Wehrhahn-Anschlag zeitlich so weit wie gerade eben möglich verschoben, um der Ermittlungskommission Zeit für ihre Arbeit und letztendlich die angestrebte Festnahme von S. zu geben. Nun aber war der PUA im Februar 2017 gezwungen, das Thema auf die Tagesordnung zu setzen, da das Ende der Legislaturperiode und damit auch der Untersuchung kurz bevorstand. Für die diskrete „Rückendeckung“ durch den PUA bedankte sich Herrenbrück in der Pressekonferenz. Ebenso bei der „Arbeitsgruppe ‚Operative Fallanalyse‘“ (OFA) des LKA NRW, die mit einem „exzellenten Bericht die Aufklärung des Falles […] wesentlich unterstützt“ hätte.
Die Ermittlungen gegen Ralf S. neu aufgenommen hätten die Ermittlungsbehörden im Juli 2014, nachdem es „konkrete neue Zeugenhinweise“ gegeben hätte, so der Düsseldorfer Kripo-Chef Markus Röhrl. Man habe ein neues „Ermittlerteam“ um den neuen Leiter des Polizeilichen Staatsschutzes, Udo Moll, gebildet. Diese „EK Furche“ habe „noch einmal ganz genau und akribisch“ die alten Akten ihrer Vorgängerin „EK Acker“ durchgearbeitet, sei neuen Hinweisen nachgegangen, habe alte und neue Zeug*innen befragt und „operative Maßnahmen“ gegen den Beschuldigten durchgeführt. „Das Gesamtbild“ belaste S. schwer und werde zudem durch ein Gutachten der LKA-Profiler*innen kriminalistisch gestützt. Udo Moll erläuterte sodann, dass die von Röhrl erwähnten „neuen Zeugenhinweise“ sich u.a. auf die Aussage eines Zeugen beziehen würden, dem gegenüber Ralf S. 2014 seine Täterschaft eingestanden habe. Zu diesem Zeitpunkt seien sowohl Ralf S. als auch der Zeuge Insassen der JVA Castrop-Rauxel gewesen. S. hätte dort eine Ersatzfreiheitsstrafe abgesessen, da er eine Geldstrafe nicht bezahlt hätte. Zudem hätte die „EK Furche“ zwei „Zeugen“ ermitteln und vernehmen können, die glaubwürdig ausgesagt hätten, dass Ralf S. vor dem Anschlag „genau eine solche Tat angekündigt hätte“. Zudem sei Ralf S. Bezieher der in Düsseldorfer sehr seltenen Annoncen-Zeitschrift „Marktplatz Köln“ gewesen. In einem Exemplar dieser Zeitschrift sei der Sprengsatz eingewickelt gewesen.
Die Anklage stand nun also im Strafprozess vor der Aufgabe, über 17 Jahre nach der Tat und ohne eindeutige Beweise wie zum Beispiel DNA-Spuren oder Tatzeug*innen in der Gesamtschau zweifelsfrei nachzuweisen, dass Ralf S. die Tat begangen hatte und keine anderen Täter*innen für den Anschlag in Frage kommen. Zunächst einmal gab es die Aussage des bereits erwähnten Mithäftlings, dem zufolge S. die Tat in prahlerischer Weise eingestanden hatte. Aber würde die Strafkammer ihm Glauben schenken? Und wenn ja, hatte S. tatsächlich Täterwissen präsentiert oder womöglich nur mit dem Anschlag geprahlt, um sich wichtig zu machen? Weiterhin war nachzuweisen, dass S. im Jahr 2000 sowohl in der Lage war, unbemerkt einen TNT-Sprengsatz mit Fernzündung zu bauen und zuvor das nötige Material hierfür zu beschaffen, als auch die Bombe zu positionieren, sie im Zeitraum zwischen 15:03:16 Uhr und 15:03:46 Uhr mit Sichtkontakt zu den Opfern zu zünden und innerhalb von wenigen Minuten unbemerkt zurück in seine Wohnung zu gelangen, um von dort um 15:07:42 Uhr einen privaten Anruf über seinen Festnetzanschluss abzusetzen. Und dass er nicht nur dazu in der Lage gewesen wäre, sondern das auch planmäßig umsetzte. Zudem war nachzuweisen, dass S. einen „Konflikt“ mit der Opfergruppe, also mit Sprachschüler*innen der Sprachschule Welling hatte, der ihn letztendlich motivierte, einen Plan zu schmieden, sie auszukundschaften und anschließend eine zufällig zusammengesetzte Gruppe von Sprachschüler*innen zu ermorden.
Eine besondere Bedeutung für die Ermittler*innen, die Anklage und den Strafprozess hatte der Bericht der LKA-Profiler*innen über ihre „Operative Fallanalyse“ des Wehrhahn-Anschlags, die von der „EK Furche“ beim LKA angefragt worden war und im November 2015 geliefert wurde. Den Profiler*innen lagen hierbei nur die objektiven Tatmerkmale vor, keinerlei Spurenakten oder gar Hinweise zu Tatverdächtigen. Deutlich wurde aus diesem Bericht, dass sich der Sprengstoffanschlag am Wehrhahn gezielt gegen die Sprachschüler*innen gerichtet hatte und der Ort des Anschlags sehr präzise ausgewählt wurde. Dem Bericht zufolge weise „der Täter im Wesentlichen – allein oder im Verbund mit anderen – neun Eigenschaften und Befähigungen“ auf, so Oberstaatsanwalt Herrenbrück in seinem Plädoyer zum Ende des Strafprozesses:
Erstens eine „fremdenfeindliche Grundmotivation“, die im Fall von S. durch viele Zeug*innenaussagen und die Telekommunikationsüberwachung (TKÜ) hinreichend belegt sei, ebenso wie seine „antisemitische Grundeinstellung“.
Zweitens eine „tiefe Verwurzelung der Fremdenfeindlichkeit“ und eine „Handlungsaggressivität“. Es sei „hervorzuheben, welchen außergewöhnlichen und mit Gewaltphantasien verbundenen Hass der Angeklagte gerade auf die Opfergruppierung der jüdischen Kontingentflüchtlinge und unter diesen auf die ihm bekannten Sprachschüler besitzt“, so der Oberstaatsanwalt. S.‘„Bereitschaft auch zur Handlungsaggressivität“ sei von vier Zeuginnen, allesamt ehemalige Beziehungspartnerinnen von S., „eindrucksvoll bestätigt“ worden. „Fünf Gewaltschutzanordnungen und vor Angst zitternde oder in ihrer Aussagekonzentration beeinträchtigte Zeuginnen“ seien hier „beredter Beleg“. Der Sachverständige Dr. Kutscher habe in „seinem mündlichen Gutachten zum Persönlichkeitsbild ergänzend“ ausgeführt, dass „eine als maligner Narzissmus zu diagnostizierende Persönlichkeitsakzentuierung anzunehmen sei, bei welcher der Betreffende eben gerade auf erlittene, für ihn nicht anders handelbare Kränkungen mit Bösartigkeit reagiere. Und genau diese Akzentuierung kommt neben dem eiskalten ideologisch motivierten Täter als einzig taugliches Persönlichkeitsbild vom Wehrhahnattentäter in Betracht.“
Als dritte Tätereigenschaft bzw. Befähigung benannte die OFA laut Plädoyer des Anklagevertreters, dass beim Täter „Vorbelastungen“ im „Bereich der politisch motivierten Kriminalität in Form von Schmierereien, Beleidigungen, Sachbeschädigungen, Bedrohungen“ zu erwarten seien, möglicherweise auch „Körperverletzungsdelikte, aber auch Verstöße gegen das Waffen- oder Kriegswaffenkontrollgesetz sowie Brandstiftungsdelikte.“ Auch das träfe zu: Der Angeschuldigte sei „wegen eines Teils der angeführten Delikte“ bereits verurteilt worden.
Als vierten Punkt benannte die OFA eine „Abneigung gegen die Opfergruppe“ sowie ein „sozialer Vorkontakt“. Einen Konflikt zwischen Sprachschüler*innen und Neonazis gab es wohl tatsächlich im Oktober 1999 vor dem Gebäude mit den Unterrichtsräumen, das im Kreuzungsbereich Gerresheimer Straße / Worringer Straße und damit direkt gegenüber dem Militaria-Shop von Ralf S. lag. Von diesem Konflikt hatten die Ermittlungsbehörden auch wenige Wochen nach dem Wehrhahn-Anschlag Kenntnis bekommen durch eine Zeuginnenaussage einer Sprachlehrerin, ohne der Sache damals nachzugehen bzw. Bedeutung beizumessen, weswegen die neonazistischen Akteure bis heute unbekannt sind. Die Lehrerin hatte ausgesagt, dass sich etwa ein Dreivierteljahr vor dem Anschlag zwei martialisch gekleidete Neonazis mit Hunden vor Beginn eines jeden Schultages über mehrere Wochen vor den Eingang des Gebäudes postiert hätten. Angriffe hätte es zwar weder körperlich noch verbal gegeben, die Schüler*innen seien jedoch gezwungen gewesen, zwischen den beiden durchzugehen, um ins Gebäude zu gelangen, was einige sehr verängstigt hätte. Die beiden Neonazis hätten in sichtbarem Kontakt zum Inhaber des Militaria-Ladens, also zu Ralf S., gestanden und sich zeitweise auch vor und im Laden aufgehalten. Der „Spuk“ habe erst aufgehört, nachdem die Schüler*innen demonstrativ deutlich gemacht hätten, dass sie nicht bereit seien, das tägliche Spalier-Laufen länger zu dulden. Nach Auffassung der Staatsanwaltschaft sollten die Sprachschüler*innen durch das beschriebene Vorgehen eingeschüchtert und letztendlich vertrieben werden. Der Plan sei aber gescheitert – und Ralf S. hätte ob der „Niederlage und Demütigung“ einen neuen, effektiveren Plan geschmiedet. Dass sich S. von „Ausländern“ vor seinem Laden bzw. „ausländischen Nachbarn“ gestört fühlte, bestätigten auch der 1999/2000 als V-Mann für den VS tätige damalige Neonazi André M., der temporär für S. arbeitete, und andere Zeug*innen. S. habe „angekotzt“, dass „die Leute immer permanent an seinem Laden hin- und hergelaufen“ seien.
Als fünften Punkt benannte die OFA den zwingenden Regionalbezug, also die nötige Ortskenntnis des Täters, der seine Opfer zur Planung seines Attentats über einen längeren Zeitpunkt ausgespäht haben müsste, was für einen auswärtigen Täter kaum möglich gewesen wäre ohne dabei aufzufallen. Laut Anklage hatte S. die Opfergruppe ausgekundschaftet. Eine ehemalige Nachbarin von S. sagte vor Gericht aus, kurz vor der Tat mehrfach beobachtet zu haben, dass sich S. um 15:00 Uhr herum im Kreuzungsbereich Gerresheimer Straße / Ackerstraße an der Bushaltestelle aufgehalten hatte – ohne einen Bus zu besteigen oder einen anderen erkennbaren Grund. „Im Einklang hiermit stehend weisen die Verbindungsdaten des Angeklagten an zahlreichen Bezugstagen [Anmerkung des Autors: jeweils Donnerstage, so wie auch der Tattag] in den Wochen vor der Tat für diesen Beobachtungszeitraum keine Gespräche aus“, so Herrenbrück in seinem Plädoyer. Aber „gleich mehrfach“ sei der „erste Anruf nach längerer Pause genau um 15:07 Uhr“ erfolgt, „exakt wie am Tattag“. Hinweise „auf eine andere Person, die den späteren Tatort beobachtet haben könnte“ gebe es nicht.
Der sechste, siebte und achte Punkt, die die Anklage aus dem OFA-Bericht benannte, beziehen sich auf die nötigen Fertigkeiten, Kenntnisse und infrastrukturellen Möglichkeiten des Täters mit Bezug auf den Bau des Sprengsatzes und die Beschaffung des TNT. Dazu gehört u.a., dass für den Bau ausreichend Kenntnisse vonnöten waren, ein Schweißgerät und andere Werkzeuge sowie das TNT zur Verfügung gestanden haben müssen – sowie ein Ort, an dem der Sprengsatz ungestört gebaut werden konnte. In punkto Örtlichkeit hatte sich S. nach Auffassung der Anklage – obwohl pleite und 200 Meter entfernt bei seiner Lebensgefährtin wohnhaft – im November 1999 eine eigene Wohnung im Haus Gerresheimer Straße 13 angemietet, um ungestört seinen Plänen nachgehen zu können. Über die Existenz der Wohnung, die ihm ab Januar 2000 zur Verfügung stand, habe S. großteils Stillschweigen bewahrt. Selbst seine Freundin durfte sie offenbar nur ein oder zwei Mal betreten. Über ein Schweißgerät habe S. auch verfügt, ebenso wie über ausreichende Kenntnisse, dieses zu benutzen. Nach Auffassung der Staatsanwaltschaft war S. „als jahrelanger Zeitsoldat und Sammler von Militaria Artikeln mit der Wirkweise von Sprengstoff vertraut“. Zudem sei bei einer Hausdurchsuchung neben einem Handgranatenring und zahlreichen Sprengkörpernachbildungen auch „eine Anleitung für einen elektronischen Zünder“ gefunden worden. Nach den Angaben von Sachverständigen wäre ein derartiger elektronischer Zünder beim Anschlag verwendbar gewesen. Für die Beschaffung des Zünders und des „durch das Ende des Jugoslawien-Konfliktes und die Öffnung der Russischen Föderation“ für einschlägige Kreise relativ leicht beschaffbaren TNT hätte S. mehrere Möglichkeiten gehabt. Zwar habe er während seiner Bundeswehrzeit keine offizielle Ausbildung mit Sprengstoff und Sprengfallen bekommen, habe aber am Rande von Offiziersvorausbildungen zum Einzelkämpfer mitgewirkt und somit Knowhow auch im Bereich Sprengfallen und deren Tarnung gewinnen können.
Neuntens bedurfte es laut OFA zur Zündung des Sprengsatzes exakt zum gewünschten Zeitpunkt, also um möglichst viele Personen aus der Opfergruppe zu töten, eines freien Blickes auf den Tatort. Und so war es auch. Eine damals in der vierten Etage der Gerresheimer Straße 69 lebende Zeugin hatte sofort nach der Detonation aus dem Fenster geschaut und gegenüber ihrem Haus einen Mann mit Blickrichtung auf den Tatort auf einem Stromkasten sitzen gesehen, der nach der Detonation ohne Eile herunterkletterte und in Blickrichtung der Zeugin nach links um die Ecke aus ihrem Blickfeld verschwand. Es gilt als unstrittig, dass es sich hierbei um den Täter gehandelt hat. Die daraufhin erstellte Phantomzeichnung im Seitenprofil wies starke Ähnlichkeit mit Ralf S. auf, eindeutig zu erkennen war er darauf aber nicht. Die Zeugin beschrieb, dass der Mann eine vermutlich dunkelrote Basecap getragen hätte. Eben ein solches Cap soll nach Aussagen von Zeug*innen auch Ralf S. besessen, aber selten getragen haben. Eine Zeugin – damals mit Ralf S. befreundet und Betreiberin eines Tattoo-Studios – erinnerte sich daran, dass S., der sich ansonsten gerne in martialischem Militär- oder Securityoutfit und mit seinem Rottweiler auf der Straße zeigte, am Tattag zeitnah vor der Tat ein weinrotes Cappy getragen hätte, zudem weitere unauffällige Kleidungsstücke. S. Lebensgefährtin zum Tatzeitpunkt will ihn sogar im Rahmen der Ermittlungen auf dem Phantombild wiedererkannt haben.
Sämtliche von der Anklage vorgebrachten Indizien für eine Täterschaft von S. in diesem Text aufzuführen, ist leider nicht möglich, ebenso wenig wie eine nähere Erläuterung aller aufgeführten. Einige wichtige aber seien noch kurz angerissen. Über das bereits Genannte hinaus, sprachen nach Auffassung der Staatsanwaltschaft diverse weitere Indizien für eine Täterschaft von Ralf S. Dieser habe im Vorfeld der Tat planmäßig falsche Spuren gelegt, um seine Täterschaft zu verschleiern. Zudem habe er sich um den Aufbau von Alibis und „Vorwegalibis“ bemüht. Bei Letzteren ging es darum, „zur Vorbereitung der Tat für den Tatzeitkernbereich eine Legende aufzubauen, die seine Anwesenheit am Tatort erklären könnte“. Dazu habe er im Vorfeld sein nahes Umfeld hartnäckig mit Legenden gefüttert, beispielsweise, dass er am frühen Nachmittag des Tattags einen Termin mit einer Kundin in der Nähe des S-Bahnhofs hätte. Eine Kundin, die es nie gab, was S. vor Gericht letztendlich auch eingestand – ohne freilich aufzulösen, was dann Anlass seines dortigen Aufenthalts war. Zeug*innen sagten aus, sie hätten S. zwischen 13:30 Uhr und 14:30 Uhr mehrfach auf dem nördlichen Teil der Worringer Straße (von mindestens einer Stelle dort gab es damals einen freien Blick auf den Tatort, also auf die zu diesem Zeitpunkt dort bereits platzierte Plastiktüte mit dem Sprengsatz) und im Kreuzungsbereich Worringer Straße / Gerresheimer Straße gesehen, aber kein Zusammentreffen mit einer anderen Person. „Welchen Sinn aber sollte es machen“, so die Staatsanwaltschaft, „einen Geschäftstermin im Vorfeld zu erfinden und zu verbreiten, wenn es nicht darum ging, seine Anwesenheit am Tatort zu einer bestimmten Zeit mit Zeugenbestätigung erklären zu können?“
Zudem habe der Angeklagte über Täterwissen verfügt, so der Anklagevertreter. In einem abgehörten Telefonat habe Ralf S. z.B. von einem schwarzen Auto mit drei Insassen berichtet, das vor der Detonation und auch zum Tatzeitpunkt gegenüber dem Fußgängertunnel des S-Bahnhofes Wehrhahn an der Ackerstraße, also dem Tatort, geparkt gewesen sei. Dieses Auto gab es wohl tatsächlich, ein Anwohner, der keinerlei Kontakt zu Ralf S. gehabt hätte, hatte es gesehen und dies im Rahmen einer polizeilichen Haus-zu-Haus-Befragung aller Anwohner*innen ausgesagt. Somit stand die Frage im Raum, woher S. von diesem Auto wusste, obwohl er zur Tatzeit nicht am Tatort gewesen sein will.
Weiterhin führte Oberstaatsanwalt Herrenbrück im Prozess an, S. habe mehrere Zeug*innen in ihren polizeilichen Aussagen beeinflusst, sei in klassischer Tätermanier mehrfach zum Tatort zurückgekehrt, um sich über die Ermittlungen zu informieren und habe nach der Tat „geständnisgleiche Äußerungen“ gemacht, die durch die Telekommunikations- und Autoinnenraumüberwachung aktenkundig geworden seien. In einem Telefonat nach dem Anschlag habe er z.B. seiner Gesprächspartnerin mit Bezug auf eine Frau aus der Opfergruppe, die beim Anschlag ihr Ungeborenes verloren hatte, erläutert, dass das, „was ich gemacht habe“, kein Mord sondern eine „Abtreibung“ gewesen sei. Um sich dann zu korrigieren in „oder gemacht haben könnte“.

Fünf der vom Wehrhahn-Anschlag direkt betroffenen damaligen Sprachschüler*innen waren am Strafprozess gegen Ralf S. als Nebenkläger*innen vertreten und ließen sich hierbei von vier Rechtsanwält*innen vertreten. Dabei vertrat Rechtsanwältin Anne Mayer zwei der fünf Nebenkläger*innen. Insgesamt blieb die Nebenklage während des Prozesses recht blass und schloss sich in der Regel den Ausführungen und Forderungen der Staatsanwaltschaft an. Auch die Nebenklage war von der Schuld des Angeklagten überzeugt. Anne Mayer in ihrem Plädoyer: „In der Gesamtschau tragen zahlreiche Indizien und Aussagen von Zeugen und Zeuginnen zum Beweis der Täterschaft bei. Das Motiv ist klar, die Ankündigung ist deutlich, die sorgfältige Vorbereitung auf ein Alibi vor der Begehung der Tat tragen zur Überführung bei. […] Es bleibt kein ‚in dubio‘.“ Erst am 21. Hauptverhandlungstag im Strafprozess gegen Ralf S. wurde die erste Sprachschülerin gehört. Sie besuchte im Sommer 2000 einen Sprachkurs im Gebäude gegenüber dem Laden des Angeklagten, war aber am Tattag wegen eines parallelen Termins nicht vor Ort. Ansonsten wäre sie an diesem Tag wie immer über den S-Bahnhof Wehrhahn an- und abgereist. Im Prozessbericht der Prozessbeobachtungsgruppe der „Mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus NRW“ heißt es dazu: „An den Militarialaden (‚Messerladen‘) schräg gegenüber dem Sprachschulgebäude, in dessen Erdgeschoss sich ein Matratzengeschäft befunden habe, könne sie sich noch gut erinnern, so K. Sie habe sich auch einmal die Auslagen im Schaufenster angeschaut. Oft aber hätten schwarz gekleidete kurzhaarige Männer vor dem Laden gestanden. Diese hätten eine Art ‚Ziviluniform‘ bzw. Flecktarn getragen, schwarze Stiefel und militärisch wirkende Mützen. Auch einen schwarzen Schäferhund habe sie gesehen. Mitschüler*innen hätten erzählt, sie hätten weitere Hunde im Laden gesehen. Einmal – etwa eine Woche vor der Explosion – sei ihr und ihrem Mann aus den Reihen dieser Männer etwas Unfreundliches zugerufen worden, irgendwas mit ‚Ausländer‘. Sie hätten eigentlich in den Laden reingehen wollen, hätten dann aber davon Abstand genommen und fortan soweit möglich einen Bogen um diesen gemacht.“ Ein Zusammenhang zwischen der späteren Schließung des Ladens und dem Wehrhahn-Anschlag sei ihr „logisch“ erschienen. Die Prozessbeobachtungsgruppe wies in ihrem Bericht darauf hin, dass die Sprachschüler*innen in der Räumlichkeit gegenüber dem Militaria-Laden auf der Gerresheimer Straße zum Zeitpunkt des Anschlags „nicht identisch mit denjenigen“ seien, „die im Herbst 1999 von zwei Neonazis bedroht bzw. belästigt worden waren“.
Am 26. Hauptverhandlungstag wurden dann drei beim Anschlag verletzte Sprachschüler*innen als Zeug*innen gehört. Aus der vom Anschlag direkt betroffenen zwölfköpfigen Gruppe besuchten vier Personen den Sprachkurs gegenüber dem Laden des Angeklagten, eine Person hiervon blieb körperlich unverletzt. Die anderen acht besuchten einen Sprachkurs in einer Räumlichkeit auf der Ackerstraße auf der anderen Seite der Bahnlinie. Die drei damals verletzten Personen berichteten in ihren Aussagen von ihren Verletzungen, die bis dato nachwirken würden. Einer von ihnen war lebensgefährlich verletzt worden. Eine der drei Betroffenen berichtete, dass sie „den Angeklagten häufig in räumlicher Nähe der Sprachschule wahrgenommen“ habe. Im Prozessbericht heißt es über ihre Aussage weiterhin: „Dieser habe ‚einen Laden vor dem Schulgebäude‘ gehabt. ‚Ich habe ihn oft gesehen mit Camouflage-Uniform und dunklem Hund [...], eben als Soldat gekleidet.‘ Hin und wieder in Begleitung von ‚ein bis zwei Personen‘, die sie aber nicht mehr näher beschreiben könne. Sie habe damals nicht gewusst, dass es sich um Ralf S. handeln würde, das habe sie erst später aus den Medien erfahren. Vorfälle wie beispielsweise Bedrohungen von Sprachschüler*innen seien ihr nicht bekannt. Bei dem Militaria-Laden sei ihr klar gewesen, ‚worum es ging‘. Das habe man sehen können, beispielsweise an den Symbolen.“
Die Strafkammer hatte während des Strafprozesses schon recht früh deutlich gemacht, dass sie große Zweifel an der Schuld des Angeklagten bzw. an der Belastbarkeit zentraler Zeug*innenaussagen hatte. Letztendlich führte das zwischen dem 24. und 25. Prozesstag zur vorzeitigen Entlassung von Ralf S. aus der Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft und die Nebenklage konnten in den verbleibenden zwölf Prozesstagen das Ruder nicht mehr herumreißen. Und so wurde Ralf S. am 31. Juli 2018 beim 34. und letzten Prozesstag freigesprochen. In dem Urteil heißt es: „Die Kammer konnte keine Überzeugung von der Täterschaft des Angeklagten gewinnen.“ Man habe lediglich feststellen können, dass sich der Angeklagte zum Zeitpunkt der Detonation „innerhalb eines Umkreises von etwa 500 Meter“ um den Tatort aufgehalten hätte, aber nicht wo genau. Am „Wahrheitsgehalt“ der Aussage des ehemaligen Mithäftlings von Ralf S., dessen Aussage zu S.‘ Geständnis der Tat die Ermittlungen 2014 neu ins Rollen gebracht hatten, bestünden aufgrund zahlreicher Widersprüche sowie Abweichungen von früheren Aussagen „durchgreifende Zweifel“. Die „Angaben des Zeugen“ seien „nicht geeignet, die Kammer davon zu überzeugen, dass der Angeklagte dem Zeugen tatsächlich die Tatbegehung eingeräumt hat“. „Äußerungen, die im Sinne eines Tateingeständnisses belegen würden, dass der Angeklagte Urheber des Anschlags“ sei, würden sich auch in den mitgeschnittenen Telefonaten nicht finden. Ebenso zweifelte die Kammer an den Angaben zweier Zeuginnen – der Lebensgefährtin von S. zum Tatzeitpunkt und der bereits erwähnten mit S. zur Tatzeit befreundeten Betreiberin eines Tattoo-Studios –, „denen der Angeklagte eine gegen Ausländer gerichtete Gewalttat angekündigt haben soll“. Und weiter: „Soweit die Staatsanwaltschaft darüber hinaus hinsichtlich des Tatmotivs die These vertreten hat, zwischen dem Angeklagten und Besuchern der Sprachschule X sei es im zweiten Halbjahr des Jahres 1999 zu einem offenen, den Tatentschluss auslösenden Konflikt gekommen, hat die Hauptverhandlung dergleichen nicht erbracht.“ Es sei nicht belegt, dass S. die beiden als Neonazis beschriebenen Personen angeheuert hätte, näher mit ihnen bekannt gewesen sei oder der Vorfall sogar für ihn Anlass für einen Mordplan gewesen sei. „Im Übrigen verblieben als Entscheidungsgrundlage nur Beweisanzeichen, die teils für und teils gegen eine Täterschaft des Angeklagten sprechen, die jedoch im Rahmen der von der Kammer vorgenommenen Gesamtwürdigung letztlich keine tragfähige Grundlage für eine Überzeugung von der Schuld des Angeklagten bilden.“
Darauf, dass die Kammer den Angeklagten nicht nur aufgrund der ihrer Meinung zu dünnen Beweislage freigesprochen haben könnte, sondern weil sie der Auffassung war, dass Ralf S. unschuldig ist, deuten insbesondere zwei Aspekte. Zum einen hatte der Vorsitzende Richter mehrfach durchblicken lassen, dass er S. nicht für fähig hält, eine derart komplexe Tat zu planen und erfolgreich durchzuführen, erst recht nicht, ohne dabei erwischt zu werden oder sich anschließend zu verraten. Aufgrund seiner Persönlichkeitsstruktur („Imponiergehabe“, „ausgeprägte narzisstische Akzentuierung“ etc.) habe es S. offenbar sehr gefallen, dass man ihm die Tat zutrauen würde – und im Sinne einer „Persönlichkeitsaufwertung“ entsprechend damit kokettiert. Eben damit hatte auch die Verteidigung argumentiert. Ihr Mandant sei ein „Dampfplauderer“, habe sich wichtiger und kompetenter gemacht, als er eigentlich sei und sei überhaupt nicht in der Lage, einen Sprengsatz zu bauen, wie er eingesetzt wurde.
Zudem bezweifelte die Kammer auf Grundlage eigener Messungen, dass es S. möglich gewesen wäre, in der zur Verfügung gestandenen Zeit (zwischen 3:56 Minuten und 4:26 Minuten, exakter ließ sich der Zeitpunkt des Anschlages nicht eingrenzen) zwischen der Detonation und seinem aus seiner Wohnung abgesetzten Festnetztelefonat, die Wegstrecke vom Stromkasten, von dem aus die Bombe aktiviert wurde, bis in seine Wohnung in einem gerade eben noch unauffälligen Tempo (Mittelwert zwischen „gemächlich“ und „zügig“) zurückzulegen. Der Leiter der „EK Furche“, Udo Moll, war in seiner Zeugenaussage vor Gericht zu einem anderen Ergebnis gekommen. Die Prozessbeobachtung der „Mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus NRW“ notierte zu seiner Aussage in ihrem Prozessbericht das Folgende: „Bis dahin [so Moll] seien es 383 Meter, die im verfügbaren Zeitfenster zwischen Detonation und Telefonat bequem zu bewältigen gewesen seien – im vollzogenen Test in 3 Minuten, 37 Sekunden, inklusive Aufschließen der Haus- und der Wohnungstür und der Zeit, um in die erste Etage zu kommen. Die Entfernung habe man mit einem geeigneten Gerät ausgemessen.“

1. Mai 2015 – lotta-magazin.de
Der Düsseldorfer Wehrhahn-Anschlag.
Ein Rück- und Ausblick (fast) 15 Jahre danach
1. Februar 2017 – endstation-rechts.de
Neonazistischer Bombenleger?
11. Februar 2017 – nrw.nsu-watch.info
Sitzung vom 7. Februar 2017 – Zusammenfassung
21. Februar 2017 – nrw.nsu-watch.info
Sitzung vom 17. Februar 2017 – Zusammenfassung
3. März 2017 – lotta-magazin.de
(Nicht)Aufklärung mit vielen Fragen.
Der Düsseldorfer Wehrhahn-Anschlag im Jahr 2000
24. April 2017 – lotta-magazin.de
(Nicht-)Aufklärung mit vielen Fragen.
Aktualisierung der Erkenntnisse über den Düsseldorfer Wehrhahn-Anschlag
8. Dezember 2017 – endstation-rechts.de
Nach 17 Jahren: Neonazi-Attentäter kommt vor Gericht
19. Januar 2018 – nrw.nsu-watch.info
„NSU Watch NRW“ fordert Untersuchungsausschuss zum Wehrhahn-Anschlag
22. Januar 2018 – endstation-rechts.de
Zwölffacher Mordversuch vor Gericht
26. Januar 2018 – endstation-rechts.de
Mutmaßlicher Bombenleger bestreitet die Tat
26. Februar 2018 – endstation-rechts.de
Wehrhahn-Prozess: „Was ich da gemacht habe...haben soll“
2. März 2018 – terz.org
Kooperativ verdunkelt?
9. März 2018 – endstation-rechts.de
Wachsende Indizienkette im Wehrhahn-Prozess
1. April 2018 – terz.org
Auslöser übersehen
29. April 2018 – terz.org
Eitler Anschlag
6. Mai 2018 – lotta-magazin.de
„Die Tat nicht zugetraut...“
Aktueller Erkenntnisstand bei der Aufklärung des Wehrhahn-Anschlags
17. Mai 2018 – nrw.nsu-watch.info
Erklärung von „NSU Watch NRW“ zur Entlassung des Angeklagten aus der U-Haft
22. Mai 2018 – endstation-rechts.de
Wende im „Wehrhahn-Prozess“
1. Juni 2018 – terz.org
Dringend: Aufklärung
3. Juli 2018 – terz.org
Angst essen Aussage auf
1. August 2018 – nrw.nsu-watch.info
Pressemitteilung und Stellungnahme zum Urteil im Wehrhahn-Prozess
2. August 2018 – endstation-rechts.de
Wehrhahn-Prozess: Wie es zum Freispruch für Ralf S. kam
27. August 2018 – terz.org
Prinzipiell unaufgeklärt: Erste-Klasse-Freispruch im Wehrhahn-Prozess
30. Oktober 2018 – lotta-magazin.de
„Ein Urteil darf nicht die Fehler der Ermittlungsbehörden vertuschen“.
Interview mit Rechtsanwalt Alexander Hoffmann
30. Oktober 2018 – lotta-magazin.de
„Ein Untersuchungsausschuss ist notwendiger denn je“.
Die Rolle des VS beim Wehrhahn-Anschlag ist unaufgeklärt
30. Oktober 2018 – lotta-magazin.de
Über 18 Jahre Nichtaufklärung.
Der Wehrhahn-Prozess: Überblick und Bilanz
30. Oktober 2018 – lotta-magazin.de
„Niemand kam und fragte: Wie geht es Ihnen?“
Die Betroffenen des Wehrhahn-Anschlags
14. Januar 2021 – endstation-rechts.de
Militaria-Neonazi bleibt unbehelligt
21. Januar 2021 – nrw.nsu-watch.info
Wehrhahn-Anschlag nicht ausermittelt.
Der Verfassungsschutz hätte zur Aufklärung des Bomben-Anschlages vom 27. Juli 2000 beitragen können.
29. Januar 2021 – terz.org
Schlussstrich ist keine Aufklärung
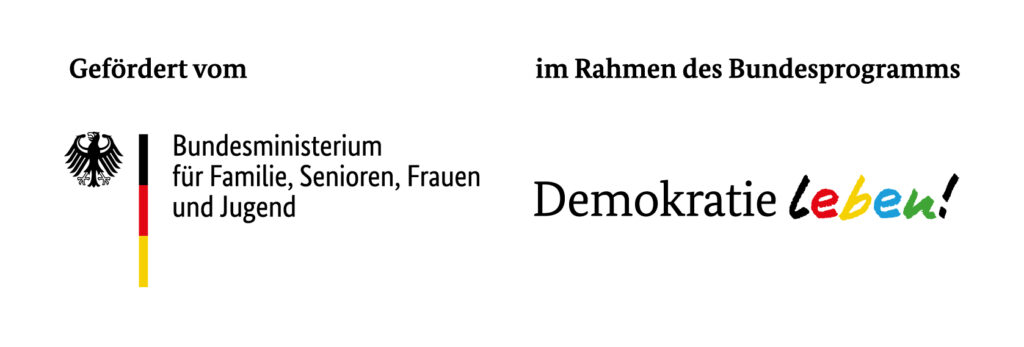

Mit freundlicher Unterstützung des Zweck e.V.