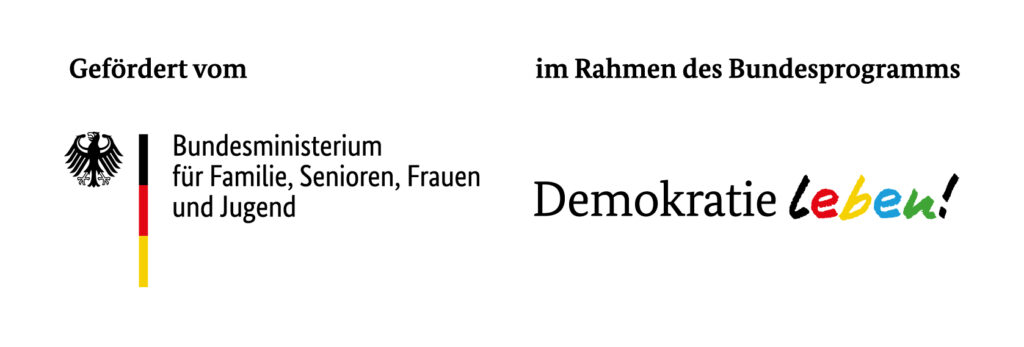Antisemitismus in Düsseldorf
Der Wehrhahn-Anschlag hatte einen extrem rechten, antisemitischen, rassistischen und antislawistischen Hintergrund. Auch wenn die Tat juristisch nicht abschließend aufgeklärt werden konnte und die vorliegenden Indizien nicht ausreichten, um den mutmaßlichen Täter zu überführen, besteht an der Motivation kein ernsthafter Zweifel.1. Der Tatverdächtige betrieb in unmittelbarer Nähe zum Tatort ein Militaria-Geschäft und war in der extrem rechten Szene aktiv. Auch wurden bereits vor dem Anschlag aus dem Umfeld seines Ladens Feindseligkeiten gegenüber den Schüler*innen einer nahegelegenen Sprachschule verübt. Die Menschen, die am 27. Juli 2000 durch den Anschlag teilweise schwer verletzt…