
Zwölf Menschen umfasste die Gruppe der Betroffenen des Anschlags am S-Bahnhof Wehrhahn in Düsseldorf am 27. Juli 2000. Im Gerichtsverfahren, in den Medien und in der Stadtgesellschaft spielte der Blick auf die Betroffenen lange eine untergeordnete Rolle. Vieles wissen wir nicht, denn die Perspektiven und Erfahrungen der Betroffenen wurden bisher kaum erfragt und erforscht. Zudem wurden einige damals von der Jüdischen Gemeinde aus guten Gründen vor dem Medienrummel geschützt. Dieser Text trägt einige der Informationen zusammen, die öffentlich bekannt wurden; zeigt, wo sie sich selbst zu Wort meldeten und beschreibt, wie mit ihnen umgegangen wurde.
Die Betroffenen waren Einwanderer*innen aus Staaten der ehemaligen Sowjetunion, aus Russland, der Ukraine, Aserbaidschan und Kasachstan. Es war eine heterogene Gruppe mit verschiedenen Religionen, unter ihnen waren unter anderem sechs jüdische sogenannte Kontingentflüchtlinge, Menschen muslimischen und christlichen Glaubens, außerdem Russlanddeutsche bzw. Spätaussiedler*innen. Zehn dieser Menschen wurden verletzt, teilweise schwer. Eine schwangere Frau verlor ihr ungeborenes Kind. Vor Gericht wird eine Betroffene später berichten, dass die Wucht der Bombe sie fast über das Brückengeländer gedrückt habe.
Schon kurz nach dem Anschlag mussten die Betroffenen mit Spekulationen über den Hintergrund des*der Täter*innen umgehen, die sich auf ihre Herkunft bezogen. Die Polizei verfolgte verschiedene Ermittlungsansätze und stellte dabei auch das direkte Umfeld der Anschlagsopfer unter Verdacht, auf der Suche nach dem Motiv für die Tat. Die Bild-Zeitung und der WDR spekulierten, ob es sich um eine Beziehungstat gehandelt haben könnte (vgl. WDR 2023). Ein weiteres Narrativ lautete, einige Betroffene hätten den Status als „Kontingentflüchtling“ illegal erworben und dafür möglicherweise Schulden bei der „Russen-Mafia“, der organisierten Kriminalität, gemacht. Diesen Ansätzen wurde parallel zum damaligen Ermittlungsverfahren gegen Ralf S. nachgegangen. Es gab und gibt für diese Theorien bis heute keinerlei Belege1 (vgl. Lange 2018).
Die Betroffenen traten nach dem Anschlag nicht öffentlich in Erscheinung. Michael Szentei-Heise, damals Geschäftsführer der Jüdischen Gemeinde in Düsseldorf (JGD), erinnert sich: „Wir haben sie damals extrem abgeschottet.“ (Sieckmeyer 2018). Die JGD habe sich um die Betroffenen gekümmert, da die jüdischen „Kontingentflüchtlinge“ bereits von der Gemeinde bei der Ankunft in Deutschland unterstützt worden waren und Kontakte bestanden. Für die Betroffenen wurden darüber hinaus Spenden in Höhe von 72.505 D-Mark gesammelt (vgl. Lieb/ Ruhnau 2017). Zu Prozessbeginn sagte Szentei-Heise: „Wir erhoffen uns eine Verurteilung, damit die Betroffenen von damals mit der Tat abschließen können. Denn das ist schon eine große Belastung.“ (RP 2018).
Ekaterina Pyzova äußerte sich als einzige Betroffene öffentlich zu den Folgen des Anschlags. Ursprünglich aus Kasachstan stammend, besuchte auch sie einen Deutschkurs, der damals obligatorisch für die Eingewanderten war. Nach ihrem Studium in Moskau hatte sie in leitender Position als Kauffrau in einem Stoffgroßhandel gearbeitet. Aufgrund der erlittenen lebensgefährlichen Verletzungen musste sie den Sprachkurs nach dem Anschlag abbrechen und bemühte sich nach der Genesung um eine Qualifizierung für den deutschen Arbeitsmarkt. Das Jobcenter empfahl ihr statt einer qualifizierten Umschulung eine Arbeit als Reinigungskraft. Es gelang Ekaterina Pyzova nicht, in ihren alten Beruf zurückzukehren. Niemand habe nach dem Anschlag Interesse an ihr gezeigt, Hilfsangebote habe es nicht gegeben, eine Entschädigung für die erlittenen Verletzungen hätten die Betroffenen nicht erhalten, obwohl man noch unter den Folgen zu leiden hätte, kritisierte sie mehrfach öffentlich, unter anderem 2018 in einem Beitrag vom WDR. Der damalige Düsseldorfer Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) war der erste politische Verantwortliche, der daraufhin die Situation der Betroffenen vom Wehrhahn-Anschlag zur Kenntnis nahm und Ekaterina Pyzova ins Rathaus einlud (vgl. Lange 2018).
Vor Gericht beschrieben drei weitere Betroffene, wie sie den Anschlag erlebt hatten. Eine Person erinnerte sich, sie sei von der Wucht der Bombe beinahe über das Geländer der Brücke gedrückt worden. Ihr hätten Splitter entfernt werden müssen und aufgrund weiterer Verletzungen sei eine Knieoperation notwendig geworden. „Wir gingen vorn, das war unser Glück. Die hinter uns waren viel schwerer verletzt.“, sagte sie aus (vgl. MBR 2018). Eine andere Betroffene berichtete ebenfalls vor Gericht von der Entfernung eines großen und mehrerer kleiner Splitter. Sie habe darüber hinaus immer noch eine chronische Sehnenverletzung am linken Bein. Ein weiterer Betroffener beschrieb im Gerichtsprozess wiederholte Operationen aufgrund von Verletzungen durch die Splitter der Bombe 2(vgl. Geilhausen 2022).
Für die Jüdische Gemeinde war der Anschlag ein Schock. Wegen der Tatsache, dass es sich bei den Anschlagsopfern teilweise um Juden und Jüdinnen handelte, ging man früh von einem antisemitischen Motiv aus. Dr. Oded Horowitz, heute Vorstand der Jüdischen Gemeinde Düsseldorf, blickte 2023 in einem Interview zurück: Nach dem Fall der Mauer und dem Zuzug von Menschen aus der ehemaligen Sowjetunion habe man die Jüdische Gemeinde in Düsseldorf wieder neu belebt. Niemand habe damit gerechnet, dass so ein Anschlag möglich sei. Viele eingewanderte Gemeindemitglieder hätten sich jedoch nach dem Anschlag die Frage gestellt, ob es richtig war, nach Deutschland gekommen zu sein. Einzelne aus der Gemeinde seien als Reaktion aus Deutschland weggezogen. Der Anschlag sei Auslöser dafür gewesen, dass die Menschen vorsichtiger geworden wären und es vermieden hätten, mit jüdischen Symbolen wie der Kippa öffentlich aufzutreten, um nicht Opfer von Anschlägen zu werden (vgl. WDR 2023). Nach dem Brandanschlag auf die Synagoge in Düsseldorf am 2. Oktober 2000 äußerte sich einer der Betroffenen des Wehrhahn-Anschlags gegenüber der Welt am Sonntag: „Wir sind schockiert, aber wir bleiben.“
18 Jahre nach dem Anschlag kam es zu einem Gerichtsprozess, in dem fünf der Betroffenen als Nebenkläger*innen auftraten. Nebenkläger*innen haben die Möglichkeit, sich als Betroffene der Anklage der Staatsanwaltschaft anzuschließen. Sie sind dadurch nicht nur auf die Rolle der Opfer bzw. Zeug*innen beschränkt, sondern können selbst - oder vermittelt durch eine*n Nebenklageanwält*in - eine aktive Rolle im Gerichtsprozess einnehmen. Nebenkläger*innen können unter anderem Zeug*innen oder Angeklagte befragen, eigene Beweisanträge stellen, ein eigenes Abschlussplädoyer halten und ein Strafmaß fordern. Tobias Degener, Nebenklageanwalt, formulierte die Erwartungen der Betroffenen an den Prozess wie folgt: „Sicherlich Aufarbeitung, Aufklärung und sie wollen begreifen, was da passiert ist und auch, was in dem Kopf von dem Angeklagten vorgegangen ist." (WDR 2018).
Drei der Betroffenen wurden erst am 26. Prozesstag als Zeug*innen in den Prozess einbezogen, rund drei Wochen, nachdem der Angeklagte bereits aus der Haft entlassen worden war. Dies ist in Strafprozessen durchaus unüblich, wie die Journalistin Stefani Geilhausen feststellt, denn üblicherweise werden Opferzeug*innen gleich nach der Vernehmung der*des Angeklagten gehört (vgl. Geilhausen 2022). Dass die Betroffenen in dem ganzen Komplex nicht im Mittelpunkt standen, ist ein Eindruck, der sich vielen Beobachter*innen immer wieder aufdrängte.
In ihren Aussagen vor Gericht schilderten die Zeug*innen, wie bereits beschrieben, die Auswirkungen des Anschlags. Die symbolische Gegenwehr von Sprachschüler*innen gegen Einschüchterungsversuche durch Neonazis aus dem Umfeld des nahe gelegenen Militaria-Ladens wertete die Staatsanwaltschaft im Gerichtsverfahren als tatauslösend. Keine*r gab jedoch an, sich an Vorfälle im Umfeld der Sprachschule zu erinnern. Eine Betroffene erinnerte sich lediglich vor Gericht, den Angeklagten in Tarnuniform und in Begleitung eines Hundes in der Nähe der Schule gesehen zu haben. Auch seinen Militaria-Laden in der Nachbarschaft habe sie wahrgenommen und ihr sei wegen Symbolen aus der rechten Szene klar gewesen, „worum es ging“ (vgl. Geilhausen 2022; MBR 2018). Eine andere Sprachschülerin, die nur durch Zufall am Tag des Anschlags nicht vor Ort war und als Zeugin aussagte, erinnerte sich ebenfalls an den Militaria-Laden. Ungefähr eine Woche vor dem Anschlag hätten ihr zwei schwarz gekleidete kurzhaarige Männer, die vor dem Laden standen, etwas Unfreundliches zugerufen, „irgendwas mit Ausländer" (MBR 2018a).
Am 26. Juli 2018 hielten die Staatsanwaltschaft und die Nebenklagevertreter*innen ihre Plädoyers vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft ging davon aus, dass die Schuld des Angeklagten zweifelsfrei bewiesen sei. Die Nebenkläger*innen unterstützten diese Einschätzung der Staatsanwaltschaft. Der Nebenklageanwalt Michael Rellmann sagte, bezogen auf die Widersprüchlichkeiten in den Aussagen des Angeklagten: „Wie vieler Versprecher, unbedachter Äußerungen, Geständnisse und Nebelkerzen des Angeklagten bedarf es, um den Zweifelsgrundsatz außer Kraft zu setzen? Theoretische Zweifel reichen für einen Freispruch nicht.“ (Geilhausen 2022). Rechtsanwalt Juri Rogner, ebenfalls Teil der Nebenklage, warnte das Gericht im Falle eines Freispruchs „den schwersten Justizfehler in der Geschichte Düsseldorfs zu begehen." (WZ 2018). Die Nebenklageanwältin Anne Meyer sagte: „In der Gesamtschau tragen zahlreiche Indizien und Aussagen von Zeugen und Zeuginnen zum Beweis der Täterschaft bei. Das Motiv ist klar, die Ankündigung ist deutlich, die sorgfältige Vorbereitung auf ein Alibi vor der Begehung der Tat tragen zur Überführung bei. Ebenso die glaubhaften — und mutigen — Aussagen der Zeugen (…). Es bleibt kein „In dubio“. Für die angeklagten Taten hat der Gesetzgeber lebenslange Freiheitsstrafe bestimmt.“
Dennoch endete der Strafprozess mit einem Freispruch für den Angeklagten. Nach der Urteilsverkündung konstatierte Nebenklageanwalt Rellmann, dieser Tag sei kein guter Tag für die Justiz und ein schlimmer Tag für die Opfer des Anschlags gewesen. Sie hätten sich auf ein Urteil verlassen, das den Umständen und den Indizien gerecht wird (vgl. WDR 2018a). Sein Kollege Juri Rogner zeigte sich nach der Bestätigung des Urteils durch den Bundesgerichtshof frustriert: „Wir meinen, dass der Richtige auf der Anklagebank gesessen hat.“ (Semmelroch 2021).
Die Nebenklage äußerte sich nicht nur empört zum Freispruch, sondern trug auch über eine ihrer Rechtsanwältinnen, Anne Mayer, die Forderung nach einer Gedenktafel am Tatort in die Öffentlichkeit, denn damals erinnerte nichts an diese Geschichte. Aufgrund des öffentlichen Drucks wurde schließlich von den Bezirksvertretungen 1 und 2 in Düsseldorf die Anbringung einer Gedenktafel veranlasst. Die Textfassung wurde durch den Arbeitskreis "Orte der Erinnerung" in Rücksprache mit der Jüdischen Gemeinde Düsseldorf und der Opferberatung Rheinland formuliert (vgl. epd 2020). Sie wurde am 11. Mai 2020 am S-Bahnhof Wehrhahn angebracht. Ergänzt wurde die Tafel an der Ackerstraße durch das künstlerische Erinnerungszeichen „Spuren 2020“, das die Anschlagstelle markiert.
Während der Gedenkkundgebung zum 20. Jahrestag am 27. Juli 2020 sprach Ruth Rubinstein, die Ehrenvorsitzende der Jüdischen Gemeinde Düsseldorf. Sie war damals, als der Anschlag geschah, Vorstandsmitglied und wurde rasch informiert. Schockiert habe sie sich gefragt, ob man Betroffene kenne oder mit ihnen befreundet sei. „Als ich Gewissheit hatte, was passiert ist und wer die Opfer waren, war ich erfüllt von ohnmächtiger Traurigkeit, Fassungslosigkeit und Angst um uns als jüdische Menschen in dieser Stadt, in diesem Land“, sagte sie in ihrer Rede. Die Betroffenen seien nach Deutschland gekommen, um in Sicherheit und Freiheit leben zu können. „Umso mehr schmerzt die Tatsache, dass es der Justiz bis heute nicht gelungen ist, einen Täter zweifelsfrei zu identifizieren und ihn zu verurteilen. Das muss uns in der Tat zu denken geben“, so Rubinstein. Es sei die Verpflichtung der gesamten Stadtgesellschaft auf solche Anschläge aufmerksam zu machen, die mittlerweile bitterer Alltag seien. Statt in Rituale zu verfallen, müsse man sich couragiert zeigen. Abschließend wandte sie sich an die direkt Betroffenen: „Ihnen und ihren Angehörigen gehört mein und unser aller Mitgefühl und das Versprechen, dieses Verbrechen nie zu vergessen. Und nie mehr zu schweigen bei Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit und Rassismus.“
Ekaterina Pyzova dankte in ihrer Rede dem damaligen Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) als „dem ersten Oberbürgermeister seit dem Jahr 2000, der sich mit dem Anschlag beschäftigt hat.“ Nach Deutschland sei sie gekommen, um ein neues Leben zu beginnen: „Mit so viel Träumen und Hoffnungen. Aber dieser Tag hat mein ganzes Leben durchkreuzt.“ Bei anderen Anschlägen würde immer viel Aufwand betrieben, Täter*innen würden gefasst und Politiker*innen entschuldigten sich. „Bei uns hat es so etwas 20 Jahre lang nicht gegeben, keine Entschuldigung, keine Entschädigung. Deshalb schicke ich bittere Grüße an die Polizei, an die Staatsanwaltschaft“ (WZ 2020).
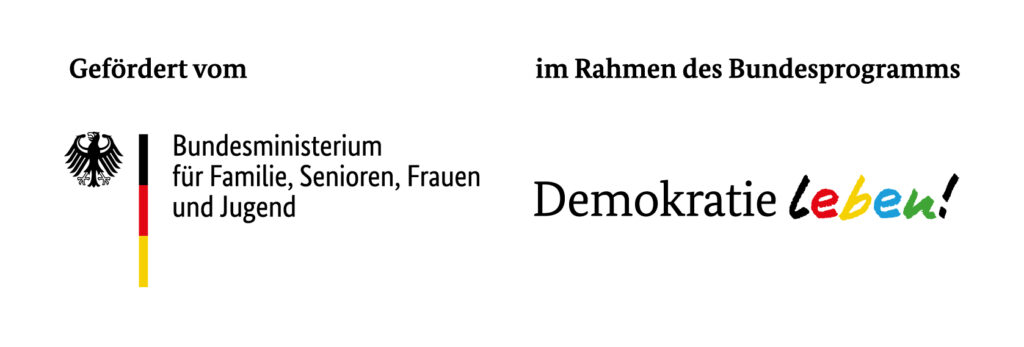

Mit freundlicher Unterstützung des Zweck e.V.