
Viel ist über die heterogene Gruppe der Betroffenen des Wehrhahn-Anschlags nicht bekannt. Ihnen allen gemeinsam ist, dass sie kurze Zeit vor dem Anschlag aus Staaten der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland eingewandert waren. Sechs von ihnen galten als sogenannte jüdische Kontingentflüchtlinge, andere als Russlanddeutsche. Heute wird der Anschlag auf diese Gruppe als antisemitisch und rassistisch erinnert. Vieles spricht dafür, dass der Täter (oder die Täter:innen) die Gruppe mit der Bombe töten wollte, weil er sie als „jüdisch“ und „russisch“ bzw. „slawisch“ wahrgenommen hatte, sich also eine antisemitische Motivation mit einem anti-osteuropäischen Rassismus verschränkte.
Aktuell leben rund 4,5 Millionen Menschen mit einer osteuropäischen Migrationsgeschichte in Deutschland. Bis 2018 wanderten ca. 2,5 Millionen Russlanddeutsche und rund 220.000 jüdische Kontingentflüchtlinge ein. Hinzu kommen hunderttausende Geflüchtete, darunter auch viele Juden und Jüdinnen, aus der Ukraine seit der Annexion der Krim im März 2014. Der russische Angriff auf die Ukraine im Februar 2022 brachte einen neuen, noch stärkeren Anstieg. Diese Fluchtbewegung hält bis heute an. Dazu kommt eine schwer zu schätzende Anzahl von Russ:innen, die das Land seit dem Krieg auch Richtung Deutschland verlassen haben.
Die Geschichte der beiden betroffenen Einwanderungsgruppen ist heute wenig präsent. Auch Anfeindungen und Gewalttätigkeiten, die Menschen mit diesen Migrations- und Fluchtgeschichten aufgrund ihrer Herkunft aus Osteuropa erleben, spielen bisher in der öffentlichen Wahrnehmung selten eine Rolle. Deswegen soll es im Folgenden darum gehen, die historischen Hintergründe der Zuwanderung der beiden Gruppen grob zu skizzieren, auf die der Sprengstoffanschlag zielte. Im Anschluss wird der anti-osteuropäische Rassismus als spezifische Form des Rassismus beschrieben werden.
Die beiden Bezeichnungen können hier synonym verwendet werden. Russlanddeutsche meint Nachfahr:innen deutscher Siedler:innen, die bereits im 18. Jahrhundert als Arbeitskräfte vom russischen Kaiserreich angeworben wurden und sich dort in verschiedenen Gebieten ansiedelten. Seitdem existierte erst in Russland, später in der Sowjetunion, immer eine deutsche Minderheit, die sich die deutsche Sprache und Versatzstücke deutscher Kultur teilweise erhielt. Vor allem während des Zweiten Weltkriegs und in der Nachkriegszeit wurden Russlanddeutsche in der Sowjetunion Opfer mehrfacher Vertreibungen, Verschleppungen und Verbannungen. Nach dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland gelten sie und ihre Nachkommen als Deutsche, denen die Rückkehr mit dem Mauerfall möglich wurde. Ab 1993 wurden sie als Spätaussiedler:innen bezeichnet.
Ihre Aufnahme in die bundesdeutsche Gesellschaft wurde im Vergleich zu anderen, im selben Zeitraum ankommenden Migrant:innen zu Beginn recht intensiv unterstützt: Sie erhielten nach Anerkennung als Spätaussiedler:innen die deutsche Staatsbürgerschaft, umfassende finanzielle Start- und Eingliederungshilfen und Deutschkurse, zudem wurde ihre Berufstätigkeit in der ehemaligen UdSSR mit einer sehr einfach zu erfüllenden Nachweispflicht für das deutsche Rentensystem angerechnet. „Diese Maßnahmen wurden jedoch aufgrund des insbesondere in der ersten Hälfte der 1990er Jahre intensiven Zuzugs von über 200.000 Menschen pro Jahr genau dann zurückgefahren, als sie am meisten benötigt wurden“, stellt Jannis Panagiotidis fest, der als Historiker zur Migration aus Osteuropa forscht. Dies führte zu ökonomischer Benachteiligung, vor allem bei der Eingliederung in den Arbeitsmarkt. Viele Ausbildungen und akademische Abschlüsse der Spätaussiedler:innen wurden nicht anerkannt, berufliche Karrieren ignoriert, so dass der Neuanfang in Deutschland in der Regel einen sozialen Abstieg bedeutete. Die Betroffenen waren auch in der Wahl des Wohnortes oder der Schule für ihre Kinder stark eingeschränkt. Diese Hürden von damals haben Auswirkungen bis heute: Auch wenn sich die meisten russlanddeutschen Haushalte ein Einkommen erarbeiten konnten, das fast an den Durchschnitt von Haushalten ohne Migrationsgeschichte heranreicht, sind Russlanddeutsche nach wie vor häufiger von staatlicher Unterstützung abhängig als Bevölkerungsgruppen ohne Migrationsgeschichte und somit strukturell benachteiligt.
Der Begriff „Kontingentflüchtlinge“ ist ein behördlicher und beschreibt einen juristischen Status, als Selbstbezeichnung wird er nicht verwendet. Grundsätzlich bezeichnet er Menschen, von denen eine festgelegte Menge, also ein Kontingent, aus völkerrechtlichen oder humanitären Gründen von einem Staat aufgenommen wird, ohne dass individuelle Asylanträge gestellt werden müssen. Bezogen auf die Einwanderung von Juden und Jüdinnen nach Deutschland wurde der Begriff seit 1991 verwendet, seit die Ministerpräsidentenkonferenz am 9. Januar beschloss, das Kontingentflüchtlingsgesetz auf Juden und Jüdinnen anzuwenden. Im Gegensatz zu den Spätaussiedler:innen aus der ehemaligen Sowjetunion erhielten jüdische Kontingentflüchtlinge nicht automatisch die deutsche Staatsangehörigkeit, konnten diese aber nach bestimmten Fristen beantragen. Sie hatten Anspruch auf eine Arbeitserlaubnis, Sozialleistungen und Integrationshilfen, wie einen kostenlosen Sprachkurs und die Unterstützung bei der Wohnungssuche. Rentenansprüche auf im Ausland geleistete Arbeit bestand dagegen nicht – womit der Status jüdischer Kontingentflüchtlinge gegenüber dem der Spätaussiedler:innen schlechter gestellt wurde. Bis heute sind erstere überdurchschnittlich oft auf Sozialleistungen angewiesen, weil die Rente aus Erwerbstätigkeit in Deutschland nicht ausreichen kann. 2005 trat ein neues Zuwanderungsgesetz in Kraft, das die jüdische Einwanderung nach Deutschland nach dem Kontingentflüchtlingsgesetz beendete und strengere Kriterien einführte. Wer heute eine Einreiseerlaubnis als Jude oder Jüdin beantragt und nicht vor 1945 geboren ist, muss in der Regel Deutschkenntnisse, eine positive Integrationsprognose und die Zusage nachweisen, Mitglied in einer jüdischen Gemeinde werden zu können.
Etwa 1,5 Millionen Juden und Jüdinnen waren im „Holocaust durch Kugeln“ von deutschen SS-Männern, Polizisten und Wehrmachtssoldaten, sogenannten Einsatzgruppen, in den besetzten Gebieten der Sowjetunion massenhaft hingerichtet worden. Ca. 500.000 jüdische Soldat:innen hatten im Zweiten Weltkrieg in der Roten Armee gegen die nationalsozialistische Wehrmacht gekämpft, jüdische Partisan:innen in ihre Reihen aufgenommen und überlebende Angehörige aus den Vernichtungslagern befreit. Jeder und jede Überlebende hatte Millionen verloren und zu betrauern.

Obwohl es auch deswegen eine hohe Bereitschaft jüdischer Menschen gab, sich mit der Sowjetunion zu identifizieren, spielte die Shoa in der sowjetischen Erinnerungskultur kaum eine Rolle. Der staatlich verordnete Atheismus hatte einen sehr hohen Anpassungsdruck zur Folge, die Ausübung von Religion und eine Sichtbarkeit jüdischen Lebens waren kaum möglich. Jüdische Identitäten wurden marginalisiert, unsichtbar gemacht und von den Betroffenen nach Möglichkeit verschwiegen, teils sogar innerhalb der eigenen Familie, um die Kinder nicht Opfer von Antisemitismus werden zu lassen. Zu Beginn noch offen arbeitende zionistische Gruppen organisierten sich gezwungenermaßen im Untergrund.
Die behördliche Identifikation jüdischer Menschen fiel leicht, denn Jüdischsein wurde in der Sowjetunion als ethnisch-nationale Kategorie betrachtet. Im Gegensatz zur religiösen (halachischen) Auslegung, die ein Kind als jüdisch definiert, wenn die Mutter jüdisch ist, galten in der Sowjetunion für den Staat diejenigen als jüdisch, die einen jüdischen Vater hatten. In den Ausweisen stand "evrej" ("Hebräer", Jude), was in der Schule, bei der Bewerbung an einer Universität, bei der Wohnungssuche und Berufswahl zu Diskriminierung führte. Ein gesellschaftlicher Aufstieg mit einem Passeintrag als Jude oder Jüdin war in der Sowjetunion unwahrscheinlich. Der Antisemitismus im Inneren spiegelte sich in der Außenpolitik wider. Anfänglich stand Stalin der israelischen Staatsgründung noch positiv gegenüber, was sich aber schnell zu Gunsten eines positiven Verhältnisses zu den arabischen Staaten änderte. Eine antisemitische Säuberungswelle fegte von 1948 bis 1953 auch über jene hinweg, die die KZ als jüdische Kommunist:innen überlebt hatten. Sie galten nun als „Agenten des Liberalismus“ und „Kosmopoliten“ oder fielen als „Zionisten“ in Ungnade. Bis in die 1980er Jahre hinein war Antizionismus staatliche Doktrin der Sowjetunion und wurde von entsprechender antisemitischer Agitation und Ausgrenzung innenpolitisch begleitet. Die Ausreise aus der Sowjetunion war für alle Bürger:innen nahezu unmöglich, Anträge wurden selten genehmigt. Von 1954 bis 1964 gelang es nur 1.542 Juden und Jüdinnen die Sowjetunion in Richtung Israel verlassen. Ab 1965 stieg die Zahl der Ausreisegenehmigungen. Laut dem Historiker Frank Grüner war es vor allem „den Auswirkungen des Sechstagekrieges zwischen Israel und den arabischen Staaten 1967 geschuldet, dass die Situation für die sowjetischen Juden aufgrund der massiven antizionistischen Propaganda und antisemitischen Stimmungen in der Sowjetgesellschaft zunehmend unerträglich wurde und der öffentliche Druck auf die Sowjetführung nach Genehmigung von Ausreisen anstieg“.

Seit den 1970er Jahren hatten ca. 70.000 Juden und Jüdinnen der Sowjetunion den Rücken gekehrt. Die Perestroika, die Demokratisierungs- und Modernisierungsprozesse, die ab 1986 unter Michail Gorbatschow in der Sowjetunion einsetzte, brachte für die meisten Juden und Jüdinnen massive Verunsicherungen. Mit der neu errungenen Meinungs- und Pressefreiheit kam nun auch zum Ausdruck, dass der Antisemitismus nicht nur von oben ausgeübt worden war, sondern gesellschaftlich verankert war. Russisch-nationalistische und extrem rechte Kräfte äußerten sich offen antisemitisch. Unter den ca. 1,5 Millionen Juden und Jüdinnen grassierte die Angst während der Wirren Opfer von Pogromen zu werden. Massenhaft wurden Juden und Jüdinnen entlassen, drangsaliert und zur Ausreise gezwungen, was deutliche Folgen hatte: Bis 1989 verließen etwa 11% der jüdischen Sowjetbevölkerung aller Schwierigkeiten zum Trotz die SU und weitere Staaten des Ostblocks. Mit der offiziellen Auflösung der UdSSR im Dezember 1991 kam diese jüdische Emigration zu ihrem Höhepunkt. Beliebte Ziele waren die USA, Israel und Deutschland. Deutschland versprach politische Sicherheit, war wirtschaftlich stabil und hatte geringe Hürden, so dass sich viele für den Versuch entschieden, dort ein neues Leben aufzubauen. Die Einwanderung von jüdischen Kontingentflüchtlingen nach Deutschland dauerte bis Ende 2004 an. 2003, nach den Gewaltausbrüchen der sogenannten zweiten Intifada entschieden sich sogar mehr Juden und Jüdinnen für die Einwanderung nach Deutschland (ca. 15.000) als nach Israel (ca. 12:000).
Doch in Deutschland angekommen mussten viele Juden und Jüdinnen die Erfahrung machen, dass ihnen auch hier Antisemitismus in seinen verschiedenen Formen entgegenschlug – teilweise verschränkt mit einer Ablehnung gegen ihre osteuropäische Herkunft.
Menschen mit einer osteuropäischen Migrationsgeschichte erleben eine spezifische Form gesellschaftlicher Diskriminierung, die sich aus einer langen Geschichte der westlichen Abwertung und Ausbeutung von Menschen in und aus Osteuropa speist. Im biologistisch begründeten Rassismus gegen „das Slawentum“ der Nazis und deren ideologischem Krieg gegen den „russischen Bolschewismus“ fand diese ihren gewaltsamen Höhepunkt. Der Kalte Krieg verfestigte alte Feindbilder und sorgte für neue, auch kulturrassistische Stereotype. Ressentiments gegen „den Russen“ oder „die Polen“ bestehen bis heute und sind für jene deutlich zu verspüren, die von dieser Form des anti-osteuropäischen Rassismus betroffen sind. Kritik an dieser Diskriminierung wird zunehmend sichtbar, auch weil sich Menschen mit eigener oder familiärer Migrationsgeschichte als Teil einer Post-Ost-Community mit ihren Erfahrungen zu Wort melden. Sie verweisen dabei auch mehrfache Diskriminierung, denn von Antislawismus kann ein osteuropäischer Jude aus Warschau ebenso betroffen sein wie eine nicht-Jüdin aus Kiew, eine Muslima aus Baku oder ein Rom aus Skopje. Allerdings gibt es auch Einwände gegen die Verwendung des Begriffs des anti-osteuropäischen Rassismus: Die Betroffenen würden in Deutschland nicht als people of colour, sondern überwiegend als Weiße gelesen und hätten weniger Probleme im Alltag, da ihnen sogenanntes passing möglich sei, sie sich also unerkannt in der Mehrheitsgesellschaft bewegen könnten. Befürworter:innen des Konzepts halten dagegen, dass diese Möglichkeit sehr begrenzt sei, weil Rassist:innen andere Merkmale, wie zum Beispiel den Namen oder die Sprache nutzen würden, um Betroffenen die Rolle als „Osteuropäer“ zuzuschreiben. Wie viele Menschen Opfer physischer Gewalt wurden, weil sie als „Russen“ angegriffen wurden, ist unbekannt; die Kategorie wird nicht erfasst und das Dunkelfeld ist groß. Die Amadeu Antonio Stiftung dokumentiert seit 1990 rechtsextreme Morde in Deutschland; aktuell sind es mindestens 221 Todesopfer und Dutzende Verdachtsfälle. Unter den Ermordeten sind mindestens sieben Spätaussiedler aus der ehemaligen Sowjetunion und vier Polen. Die Namen der Toten – wie etwa der von Kajrat Batesov, der 2002 in Wittstock angegriffen und beschimpft wurde und später seinen Verletzungen erlag – werden zu selten erinnert.

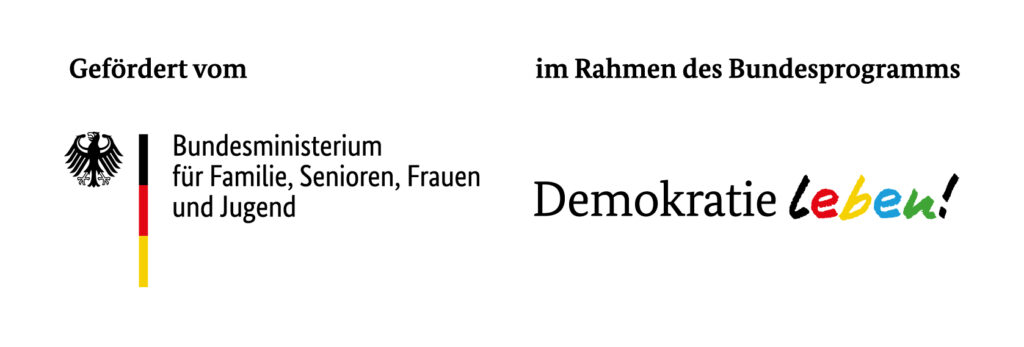

Mit freundlicher Unterstützung des Zweck e.V.