
Der Angeklagte Ralf S. war zum Tatzeitpunkt Teil der Düsseldorfer Neonazi-Szene und pflegte einen freundschaftlichen Kontakt zum damaligen Anführer der „Freien Kameradschaft Düsseldorf“, Sven Skoda. Ralf S. betrieb 1999/2000 in der Nähe des S-Bahnhofs ein Militaria-Geschäft, das gegenüber dem Gebäude gelegen war, in dem mehrere der Betroffenen einen Sprachkurs besuchten. Im Stadtteil war er durch sein Auftreten – Patrouillen durch „sein Revier“ in Tarnkleidung und mit Hund –, die Verbreitung neonazistischer Propaganda und aggressive Pöbeleien und Bedrohungen bekannt. Die Beweisaufnahme ließ auch keinen Zweifel an der antisemitischen und rassistischen Haltung des Angeklagten. Viele Prozessbeobachter*innen halten ihn trotz des Freispruchs für den Täter.
Zum Zeitpunkt des Wehrhahn-Anschlags existierte in Düsseldorf eine handlungsfähige und aktive Neonazi-Szene mit einem großen Umfeld, auch wenn von Seiten des ab Herbst 1999 amtierenden Oberbürgermeisters Joachim Erwin (CDU) sowie der Staatsanwaltschaft und des Polizeilichen Staatsschutzes immer wieder das Gegenteil behauptet oder zumindest die Gefahr klein(er) geredet wurde. Als beispielsweise im Frühjahr 1998 zwei Vertreter des „Koordinierungskreises antifaschistischer Gruppen aus Düsseldorf und dem Umland“ (ANTIFA-KOK) auf Einladung von „Bündnis 90 / Die Grünen“ und SPD auf einer Sitzung der Bezirksvertretung Flingern (BV2) über die von der lokalen Neonazi-Szene ausgehenden Gefahren berichteten, wurde ihre Einschätzung vom Polizeilichen Staatsschutz angezweifelt und das beschriebene Spektrum als „unbedeutend“ bewertet. Selbst der nordrhein-westfälische Verfassungsschutz (VS) sah das anders. War im VS-NRW-Bericht über das Jahr 1996 noch von „losen örtlichen Zusammenschlüssen von Neonazis“ – u.a. in Düsseldorf – die Rede, hieß es im Bericht über das Jahr 1998 bereits, dass der „Raum Düsseldorf und Velbert/Kreis Mettmann“ einer der „Schwerpunkte der Neonazi-Szene in Nordrhein-Westfalen“ sei und im Bericht über das Jahr 1999, dass es in Düsseldorf und fünf weiteren NRW-Städten bzw. -Regionen „gefestigte Neonazi-Strukturen“ geben würde.
In den Jahren 1999 und 2000 waren zahlreiche rechte Angriffe im Rheinland und auch in Düsseldorf zu verzeichnen. Zwei Beispiele: Am 13. Oktober 1999 quälten zwei Neonazi-Skins in Düsseldorf-Benrath unter Beihilfe einer Bekannten einen 22-Jährigen, weil dieser mit einem Schwarzen befreundet war. Sie verprügelten und folterten ihn und inszenierten seine Scheinhinrichtung. Letztendlich rettete sich das Opfer mit einem Sprung aus dem ersten Stock des Hauses, brach sich beide Beine und trug bleibende Schäden davon. Am Abend des 3. Juli 2000 griff eine Gruppe junger Neonazis auf dem S-Bahnhof Derendorf zwei Männer, die sie als „nichtdeutsch“ identifizierten, mit Eisenstangen an. Einer der beiden Angegriffenen wurde ins Gleisbett gestoßen und verletzt. Glücklicherweise kam gerade kein Zug.
Mit Blick auf organisierte Neonazis in Düsseldorf ist besonders die „Kameradschaft Düsseldorf“ (KSD) zu nennen, die sich wahlweise auch „Freie Kameradschaft Düsseldorf“ nannte, um ihre Nichtzugehörigkeit zu einer Partei zu betonen. Entstanden war sie aus den Neuorganisierungsprozessen Mitte der 1990er Jahre, die aufgrund der Verbote neonazistischer Organisationen, wie beispielsweise der „Nationalistischen Front“ (NF, Verbot am 27. November 1992) und der „Freiheitlichen Deutschen Arbeiterpartei“ (FAP, Verbot am 24. Februar 1995), nötig wurden. Im Raum Düsseldorf existierten bis zum Verbot ein NF-„Stützpunkt Düsseldorf/Mettmann“ und ein FAP-Kreisverband Düsseldorf.
Der zum Zeitpunkt des Wehrhahn-Anschlags 22-jährige KSD-„Kameradschaftsführer“ Sven Skoda aus Düsseldorf-Flingern, heute einer der bundesweit führenden Neonazikader, schrieb 2023 rückblickend auf die neunziger Jahre, dass das Verbot der FAP die Szene sehr getroffen habe, aber letztendlich sei es für viele auch ohne den bisherigen „Dreh- und Angelpunkt“ weitergegangen; dabei seien gemeinsame überregionale Aktionen wichtige Orientierungspunkte gewesen. „Die Idee der Freien Nationalisten“, also einer Organisierung abseits von Parteien in neonazistischen Netzwerken, habe damals „immer weiter Fahrt“ aufgenommen, so Skoda. Ein großer Erfolg habe sich in NRW „das erste Mal beim Protest gegen die Anti-Wehrmachtsausstellung in Bonn im Oktober 1998“ gezeigt. Gemeint ist eine knapp über 1.000-köpfige neonazistische Demonstration am 24. Oktober 1998 in Bonn unter dem Motto „Unsere Soldaten waren keine Verbrecher! Für die Ehre der Deutschen Wehrmacht!“ gegen die dort präsentierte Ausstellung „Vernichtungskrieg. Verbrechen der Wehrmacht 1941 bis 1944“. Aufmärsche zu diesem Thema erfreuten sich ab 1997 großer Beliebtheit in der extremen Rechten und sorgten für einen Mobilisierungsschub, der mit einem immer selbstbewussteren Auftreten einherging.
Bereits 1994, also noch vor dem Verbot der FAP, wurde aus FAP- und JN-Strukturen im Rheinland das „Nationale Infotelefon Rheinland“ („NIT Rheinland“) in Düsseldorf eingerichtet, das sich fortan zu einem wichtigen Knotenpunkt in der überregionalen Kommunikationsstruktur der neonazistischen Szene entwickelte und bis weit in die 00er Jahre existierte. Über das „NIT Rheinland“, dessen Nummer u.a. über Aufkleber und Banner Verbreitung fand, wurde besonders das Umfeld der organisierten Szene mittels auf einem Anrufbeantworter gesprochenen Texten über anstehende Aktionen, neue Projekte, „Material für Aktivisten“ etc. informiert. Zudem wurden aktuelle Ereignisse kommentiert. Zugleich bot das „NIT Rheinland“ über eine zweite Telefonnummer – die sogenannte „Direktleitung“ – Interessierten die Möglichkeit, direkt mit einem der „Führungskameraden“ zu sprechen, also Kontakt zur Gruppe aufzunehmen. Die Betreiber wechselten im Laufe der Zeit mehrfach, da sie aufgrund antifaschistischer Öffentlichkeitsarbeit und Interventionen unter Druck gerieten und letztendlich beschlossen, ihre Aufgabe an andere abzugeben, was zu Unterbrechungen im Betrieb führte. Es fand sich jedoch stets ein neues Mitglied der KSD, das die Aufgabe übernahm, „zum Ärger von rotem Gesindel, Staatsschutz und dem krummnasigen Bevölkerungsteil“, wie es in der Ansage des „NIT Rheinland“ vom 14. Juli 1997 in u.a. antisemitischer Diktion hieß. Die „Direktleitung“ wurde ab etwa 1997 bis in die 2000er Jahre hinein von Sven Skoda betrieben.
Aus ihrer politischen Orientierung machte die KSD nie einen Hehl. In der Ansage des NIT vom 31. Dezember 1997 wurde den mit „Nationalsozialisten! Deutsche Volksgenossen!“ angesprochenen Anrufer:innen u.a. verkündet: „Die Nationale Opposition hat auch 52 Jahre nach der großen Niederlage, nach der Auslöschung der sozialen Gerechtigkeit und Freiheit durch ihren unerbittlichen Einsatz und Opferwillen gezeigt, dass unsere Idee nicht einen Funken an Aktualität verloren [hat]. […] Revolutionär im Herzen sein und nach den Grundsätzen der nationalsozialistischen Revolution leben, darauf kommt es an. Heil Deutschland!“ An anderer Stelle wurden aus den Reihen der Kameradschaft Düsseldorf bzw. der NIT-Betreiber Juden:Jüdinnen als „Deutschland größten Feinde“ bezeichnet, die Zietenstraße (Standort der Synagoge) als Sitz dieser „Feinde“ benannt und der Tod des Vorsitzenden des Zentralrats der Juden in Deutschland, Ignatz Bubis, im August 1999 zynisch gefeiert.
Bei der KSD handelte sich um eine feste Gruppe, die zu ihren Hochzeiten im Kern aus 12 bis 15 Personen bestanden haben dürfte, und in der großen Wert darauf gelegt wurde, dass die Mitglieder ideologisch gefestigt sind, „Einsatzbereitschaft“ zeigen und verlässlich sind. Mitgliedsanwärter und -anwärterinnen hatten vor einer möglichen Aufnahme in die Gruppe eine Probezeit zu durchlaufen. Eine Hürde, an der nicht nur der vom VS NRW auf Sven Skoda angesetzte neonazistische V-Mann Andrè M. scheiterte, der letztendlich mehr Interesse an RechtsRock-Partys, Drogen und Alkohol gezeigt haben soll als an politischer Arbeit.
Zahlenmäßig drückte sich das Neonazi-Spektrum Ende der 1990er Jahre u.a. darin aus, dass bis zu 30 Neonazis aus Düsseldorf und dem nahen Umland an auswärtigen Aufmärschen teilnahmen. Als Sven Skoda am 19. Februar 2018 als Zeuge im Strafprozess zum Wehrhahn-Anschlag vor dem Düsseldorfer Landgericht von der Staatsanwaltschaft gefragt wurde, wie groß die Szene im Jahr 2000 gewesen sei, gab er an, dass es sich um „vielleicht 80“ Personen gehandelt habe. An lokalen Störaktionen, wie beispielsweise gegen eine städtische Veranstaltung zum Thema extreme Rechte in Düsseldorf am 4. Juni 1998 im Rahmen einer Anne-Frank-Ausstellung, nahmen mehrfach über 20 Personen teil. Eine andere Störaktion richtete sich gegen eine Veranstaltung mit dem Titel „Bilder einer Ausstellung. Diskussion zur Rezeption der umstrittenen Ausstellung Vernichtungskrieg. Verbrechen der Wehrmacht 1941-44“ am 13. April 2000 in der Johanneskirche am Martin-Luther-Platz, an der auch der Kurator der Ausstellung teilnahm. Hier blieb es aber im Gegensatz zur Anne-Frank-Ausstellung bei einem Versuch, dessen Gelingen von Antifaschist:innen und der Polizei verhindert wurde. Am Abend des 3. Oktobers 2000 tauchten 30 bis 40 Neonazis vor dem Initiativenhaus auf der Martinstraße in Düsseldorf-Bilk auf, um ihren Protest gegen das damals dort zweiwöchentlich stattfindende Antifa-Café und das „Offene Antifatreffen“ (OAT) auszudrücken. Solche „Anti-Antifa“-Aktionen gehörten zu den Kernthemen der KSD. So wurden systematisch Informationen und Bildmaterial über/von antifaschistischen Akteur:innen gesammelt, um eine Grundlage zu haben, gegen diese gezielter vorzugehen und diese zu bedrohen.
Die KSD war über Jahre bei fast jedem relevanten neonazistischen Aufmarsch anzutreffen. Sie wirkte federführend mit am Aufbau der neonazistischen Regionalstruktur „Nationales Bündnis Westdeutschland im bundesweiten Bündnis Freier Nationalisten und Aktionsgruppen“ (auch: „Widerstand West“), richtete mehrfach NRW-weite Vernetzungstreffen in Düsseldorf aus (z.B. am 18. September 1999 mit fast 80 Personen in einer Gaststätte in Düsseldorf-Hamm) und pflegte eine intensive Kooperation mit neonazistischen Strukturen in den Niederlanden, insbesondere mit der „Nederlandse Volks-Unie“ (NVU). Bei ihren Aktivitäten und dem Aufbau von Strukturen profitierten die Gruppe und insbesondere Sven Skoda von den langjährigen Erfahrungen und Kontakten des Neonazi-Kaders Christian Malcoci (*1963), der bis heute unweit von Düsseldorf im Rheinkreis Neuss lebt und nach wie vor – wenngleich gesundheitlich stark eingeschränkt – aktiv ist.
Ab April 2000 war die KSD dann auch im Internet präsent; dort dokumentierte sie zeitgleich die erste (und zugleich vorletzte) Ausgabe der Zeitschrift „Düsseldorfer Beobachter“, in der neonazistische Themen, mehrere mit Lokalbezug, aufgegriffen wurden. Besonders erwähnenswert ist ein „Gespräch mit einem abgeurteilten Wehrwolf“, der „vor einigen Jahren nur noch im gewaltsamen Aufstand eine Möglichkeit sah, sein Recht auf Heimat auszudrücken“. Die Rede ist von einem der Neonazis, die 1996 ein „Aus- und Übersiedlerwohnheim“ in Düsseldorf-Wersten in Brand gesetzt hatten. Als Begründung für die Gewalttat führte er an, dass er „unangenehme Erfahrung mit unseren ausländischen Mitbürgern gemacht“ habe. „Eines Tages“ sei ihm dann „einfach der Kragen geplatzt“ und er habe mit anderen ein „Zeichen setzen“ wollen.
Die in der KSD organisierten Neonazis bemühten sich, Kontakt zu ihrem Umfeld zu halten und dieses bei Aktionen einzubinden. Erwähnenswert ist auch die enge Vernetzung mit neonazistischen Strukturen im Kreis Mettmann. In der zweiten Hälfte der 1990er Jahre gab es in Düsseldorf mehrere rechte und von RechtsRock begeisterte Jugend-Cliquen, aus deren Reihen nicht nur der Kreis um Skoda mal mehr, mal weniger erfolgreich versuchte, Nachwuchs zu rekrutieren. Zu nennen ist etwa eine Gruppe, die ihren Treffpunkt auf dem Derendorfer Frankenplatz hatte und von der organisierten Neonazi-Szene umworben bzw. mit Propagandamaterial versorgt wurde. Neonazistische Propaganda rund um den Frankenplatz bis hin zu tätlichen Angriffen auf als Linke oder Nichtdeutsche wahrgenommene Personen häuften sich. Auch in anderen Stadtteilen waren derartige Cliquen anzutreffen: Ende der 1990er Jahre gab es zeitweise gleich drei Cliquen in Wersten, aber auch jeweils eine in Lichtenbroich und Ludenberg. Verfestigte, sozialarbeiterisch nicht mehr erreichbare rechte Zusammenhänge gab es zum Zeitpunkt des Wehrhahn-Anschlags mindestens in den Stadtteilen Reisholz/Hassels, Eller und Garath/Hellerhof. Zwar waren bei weitem nicht alle Szenegängerinnen und -gänger durch den organisierten Neonazismus für eine kontinuierliche politische Arbeit ansprechbar, für die Teilnahme an der einen oder anderen Demonstration, das Verbreiten von Propagandamaterial und alltägliche rechte Gewalt aber reichte es. Exakt so stellte sich auch der Hintergrund des bereits erwähnten neonazistischen Angriffs vom 3. Juli 2000 am Derendorfer S-Bahnhof dar, als Mitglieder und Fans der Düsseldorfer Neonaziskin-Band „Reichswehr“ um ein Brüderpaar aus Düsseldorf-Eller zufällig auf zwei als „nichtdeutsch“ wahrgenommene Personen stießen und diese sofort angriffen.
Bis zur Jahrtausendwende waren in Düsseldorf mehrere RechtsRock-Bands entstanden – mit unterschiedlich starker Anbindung an die organisierte Neonazi-Szene. Zu nennen wären beispielsweise „08/15“, „Barking Dogs“ (ursprünglich aus Krefeld), „Rheinwacht“, „Starkstrom“ und „Eskil“. Auch fanden mehrere Konzertveranstaltungen statt, sowohl aus der organisierten Neonazi-Szene heraus organisiert, wie z.B. Liederabende mit Frank Rennicke und „Angry Wolf“ in einer Gaststätte an der Stadteilgrenze Derendorf/Golzheim, als auch aus der rechten Skinhead/RechtsRock-Szene. Im Plattenladen „Power Station“ (später „Pawn Shop“) des „Republikaner“- und späteren NPD-Kandidaten Bernd Buse in Düsseldorf-Bilk gaben sich KSD-Mitglieder, die RechtsRock- und rechte Skinhead-Szene sowie sich als rebellisch verstehende bürgerliche „Böhse Onkelz“-Fans die Klinke in die Hand.
Einer derjenigen, die bereits Anfang der 1990er Jahre erkannte, welche Möglichkeiten die boomende Nachfrage nach RechtsRock sowohl politisch als auch finanziell bot, war der Düsseldorfer Torsten Lemmer (*1970), der als Jugendlicher zunächst bei der FDP-Jugend „Junge Liberale“ aktiv war und sich anschließend immer weiter nach rechtsaußen ins Spektrum der Partei Die „Republikaner“ (REP) radikalisierte. Diese hatten bei den Kommunalwahlen 1989 in Düsseldorf mit 6,2 Prozent einen großen Erfolg erzielt, der ihnen fünf Stadtratsmandate bescherte. Die REP-Fraktion zerfiel sehr schnell, drei Ratsmitglieder traten aus der Partei aus. Unter anderem erwuchs hieraus eine zweiköpfige Ratsfraktion der neu gegründeten „Freien Wählergemeinschaft“, die Lemmer als Fraktionsgeschäftsführer einsetzte. Zugleich wurde der FWG e.V. gegründet, dessen Pressesprecher und stellvertretender Vorsitzender ebenfalls Lemmer wurde. Unter seiner Führung entwickelte sich die FWG sehr schnell zu einem lokalen Sammelbecken der extremen Rechten aller Schattierungen bis hin zur militanten Neonazi-Szene. Ab Ende 1992 waren von der FWG ausgehende Bündnisbemühungen mit anderen extrem rechten Parteien (DVU, NPD, REP etc.) festzustellen. Nicht ohne Erfolg wurde auch versucht, bestehende Vereine und Interessengemeinschaften zu unterwandern. Verstärkt wurden die Bemühungen, rechte Jugendliche anzusprechen und Angebote für diese zu schaffen, beispielsweise mittels der Herausgabe der an Schüler:innen gerichteten Zeitung „Reflex“, der Initiierung eines „Oppositionsstammtisches“, besonders für Jugendliche, zu dem Referenten der extremen Rechten eingeladen wurden, ja sogar Angeboten, gemeinsam zu RechtsRock-Konzerten zu fahren. Letztendlich überspannte Lemmer, der inzwischen das Management der überregional bekannten RechtsRock-Band „Störkraft“ übernommen hatte, den Bogen aber, was ihn im Frühjahr 1993 seinen Job als Geschäftsführer kostete. Seine Funktionen im FWG e.V. aber behielt er. Den Niedergang der unter massiven öffentlichen Druck geratenen FWG konnte das jedoch nicht mehr verhindern. Von nun an verlagerte Lemmer seinen Schwerpunkt auf den Aufbau eines RechtsRock-Firmengeflechts.
Schon zu seiner Düsseldorfer Zeit hatte Lemmer zusammen mit anderen Akteuren, insbesondere dem ehemaligem FAP-Aktivisten Andreas Zehnsdorf aus Essen, die Musikzeitschrift „Moderne Zeiten“ (MZ) ins Leben gerufen. Zugleich wurden mit der „Creative Zeiten Verlag und Vertrieb GmbH“ und „Funny Sound and Vision Produktions- und Handelsgesellschaft mbH“ zwei Firmen gegründet, die eine für den Vertrieb von CDs und die Herausgabe der MZ, aus der 1996 das RechtsRock-Magazin „Rocknord“ wurde, die andere als Musik-Label, das RechtsRock-Bands unter Vertrag nahm und vermarktete. Bereits 1995 soll er einen Jahresumsatz im sechs- bis siebenstelligen Bereich gemacht haben. Dabei galt Lemmer in der Szene inzwischen als szenefremder Abzocker, Selbstdarsteller und eitler Geschäftsmann, dem es ausschließlich um Geld und Prestige gehe. Dennoch bestellten viele bei ihm. Selbst seine Mitarbeiter, zu denen ab Sommer 1997 auch der ehemalige Hamburger JN-Landesvorsitzende Jan Zobel gehörte, der im nahen Umfeld Lemmers eine Ausbildung zum Verlagskaufmann machte, hatten ein sehr ambivalentes Verhältnis zu ihm. Lemmer zog es letztendlich auch wieder in die Lokalpolitik – während Andreas Zehnsdorf und andere das für ihn einträgliche RechtsRock-Geschäft, bei dem er sich in den Hintergrund zurückzog, weiterbetrieben. Ab Ende der 1990er, verstärkt ab dem Jahr 2000, versuchte sich Lemmer an einer Neuauflage seiner FWG-Politik von 1992/1993, wobei arbeitsteilig vorgegangen wurde. Während er sich bei eindeutig extrem rechten Aktivitäten im Hintergrund hielt, kümmerte sich Zobel um eben dieses Feld. Junge Rechte wurden zu von Zobel geleiteten „Jugendoppositionsstammtischen“ eingeladen und dort auch mit Propagandamaterial versorgt. Die „Reflex“ und die ehemalige FWG-Hauspostille „Düsseldraht“ wurden neu aufgelegt und aus Anlass eines im Januar 2000 anstehenden Strafprozesses wurde Partei für extrem rechte Fans von „Fortuna Düsseldorf“ ergriffen. Zehntausende extrem rechte Sticker, z.B. mit dem Motto „Kein Asyl dem Drogendeal“, wurden in Umlauf gebracht – vor und auch nach dem Wehrhahn-Anschlag.
Lemmer und Zobel traten auch oft gemeinsam auf, hierzu zählten u.a. provokative Auftritte im Rathaus, die für die gewünschte skandalisierende Presseberichterstattung sorgten. Zudem wurde die Nähe zu den noch mit einem Sitz im Stadtrat vertretenen REP gesucht. Lemmer gerierte sich dabei als unbequemer „Stadtrebell“ und provozierte bewusst Reibereien mit dem für seine fehlende Distanz nach Rechtsaußen von Antifaschist:innen kritisierten CDU-Oberbürgermeister Joachim Erwin, indem er vermeintliche und tatsächliche politische und ideologische Gemeinsamkeiten mit Erwin betonte und diesen bei jeder sich bietenden Gelegenheit vorzuführen versuchte. „Der Spiegel“ berichtete Ende 2000 über diese Verbrüderungs- und Anbiederungsversuche von Rechtsaußen und über Erwins rechte Politik: „Die braune Szene Düsseldorfs feiert den CDU-Oberbürgermeister Joachim Erwin als Wegbereiter einer rechten Politik.“ Letztendlich erhielt Lemmer von Erwin ein Hausverbot im Rathaus.
1999 war noch ein weiterer neonazistischer Zuzug nach Düsseldorf zu verzeichnen, von dem Lemmer und Co, aber auch die militante Neonazi-Szene um Sven Skoda profitierten: Die bis heute aktive Neonazi-Aktivistin Melanie Dittmer hatte es aus dem Ruhrgebiet nach Düsseldorf-Heerdt verschlagen, wo sie mit ihrer Partnerin eine gemeinsame Wohnung bezog. Mehrere Artikel in der „Rocknord“ dürften aus ihrer Feder stammen, auch an einzelnen Treffen des „Jugendoppositionsstammtisches“ nahm sie teil. Zudem bot sie über ihren „Hagalaz-Versand“, für den auch das „NIT Rheinland“ Werbung machte, CDs aus dem Hause Lemmer an. Als die KSD am 28. Oktober 2000 ihren ersten Aufmarsch auf Düsseldorfs Straßen brachte, zählte sie zu den Teilnehmenden.
Der Wehrhahn-Anschlag ließ die lokale Neonazi-Szene für wenige Tage verstummen, dürfte ihren Kadern doch schnell klar gewesen sein, dass sie ins Fadenkreuz von Ermittlungen und Repression geraten würden. Das galt erst recht, nachdem es den öffentlich diskutierten Anfangsverdacht gab, dass eine Person aus dem nahen Umfeld von Sven Skoda, nämlich der erst über 16 Jahre später festgenommene und weitere eineinhalb Jahre später vom Landgericht freigesprochene Ralf S., etwas mit der Tat zu tun haben könnte. Aber bereits am 30. Juli 2000 meldete sich die KSD bzw. Sven Skoda unter dem Label „Widerstandsbüro“ zu Wort. Unter dem Titel „Juden + Bomben = Naziterror?“ hieß es: „Seit Wochen redet man von rechtsterroristischen Tendenzen in der Bundesrepublik und prompt knallt es auch schon.“ Erzählt wird hier also von einer Verschwörung, nach der womöglich Geheimdienste im staatlichen Interesse für den Anschlag verantwortlich seien, um ihn der extremen Rechten in die Schuhe zu schieben.
Nachdem sich abzeichnete, dass sich offenbar eine Tatbeteiligung neonazistischer Akteure nicht beweisen ließ, meldete sich am 12. August 2000 über die Homepage des „Düsseldorfer Beobachters“ ein „Ermittlungsausschuss Bombenstimmung in Düsseldorf“ zu Wort. Die Polizei würde sich nun endlich verstärkt um Spuren kümmern, „die in eine andere Richtung deuten“. Es werde von den Ermittlern „in Betracht gezogen, dass es sich um eine Tat eines verrückten Bombenbastlers oder sogar um eine Beziehungstat handeln könnte. Nicht ausgeschlossen wird, dass die mit TNT gefüllte Granate auch von einem der Opfer gezündet wurde!“
Um ihrem Protest gegen die vermeintlich falschen Verdächtigungen und gegen befürchtete staatliche Repression auch auf der Straße etwas entgegenzusetzen, hatten Skoda & Co. bereits im August 2000 einen Aufmarsch unter dem Motto „Wir lassen uns nicht kriminalisieren. Gegen Medienhetze und roten Terror“ in Düsseldorf geplant – quasi als Reaktion auf eine etwa 2.000-köpfige antifaschistische Demonstration am 5. August 2000, die vor dem Hintergrund Wehrhahn-Anschlag stattgefunden hatte. Der für den 12. August 2000 von Skoda angemeldete Aufmarsch wurde allerdings vom Düsseldorfer Polizeipräsidenten verboten. Rechtsmittel wurden dagegen nicht eingelegt, doch der nächste Anlauf war nur eine Frage der Zeit. Zweieinhalb Monate später, am 28. Oktober 2000, marschierten am Düsseldorfer Altstadtufer um die 300 Neonazis unter dem Motto „Meinungsfreiheit für Nationalisten. Argumente statt Verbote“. Angemeldet hatte dieses Mal der damalige Neusser NPD-Chef Reinhard Vielmal, organisiert wurde die Veranstaltung, die aufgrund massiver Gegenproteste und dadurch bedingter Unterbrechungen fünf Stunden für eine recht kurze Wegstrecke benötigte, de facto aber von Sven Skoda und Christian Malcoci. Erwartungsgemäß wertete Skodas „Widerstandsbüro“ die Aktion als Erfolg: „Der Nationale Widerstand“ sei „in Deutschland wieder eine politische Kraft geworden, die in jeder Stadt, in jedem Dorf stolz Flagge zeigt“.
In Düsseldorf wurde es um die KSD allerdings in den nächsten zwei bis drei Jahren immer ruhiger, bis überhaupt nichts mehr von ihr zu hören war – mit Ausnahme des „NIT Rheinland“. Hauptgrund für die Inaktivität der KSD dürfte gewesen sein, dass mit Sven Skoda ihre zentrale Führungsfigur ab Herbst 2002 ein deutschsprachiges Studium Software Engineering/Wirtschaftsinformatik an der „Fontys Hogeschool“ im niederländischen Venlo absolvierte und fortan auch politisch mehr in den Niederlanden als in Düsseldorf anzutreffen war. Ein ungestörtes Studium in Deutschland, erst recht in NRW oder sogar in Düsseldorf wäre angesichts seines Bekanntheitsgrades wohl kaum noch möglich gewesen. Ein Teil der KSD-Mitglieder blieb aber aktiv und trat gelegentlich noch in Erscheinung, im Jahr 2003 z.B. als „Patriotischer Freundeskreis Eller/Lierenfeld“, als Teilnehmer von Veranstaltungen (z.B. sogenannte „Bürgerabenden“ der Partei „Die Republikaner“) sowie auf zentralen bundesweiten Neonazi-Events, beispielsweise auf Rudolf-Heß-Gedenkmärschen oder am 1. Mai. Als Skoda nach Beendigung seines Studiums nach Düsseldorf zurückkehrte, schien es ihm ein großes Anliegen zu sein, seine Gebiets- und Führungsansprüche mit einem weiteren Aufmarsch zu unterstreichen. Ab dem 13. April 2006 kündigte das „NIT Rheinland“ unter der Überschrift „Bombenstimmung in Düsseldorf! – Vor dem Spiel ist nach dem Spiel!“ einen von „Freien Strukturen“ im Vorfeld der in Deutschland stattfindenden Männer-Fußball-WM veranstalteten Aufmarsch am 3. Juni 2006 in Düsseldorf an. „Kurz bevor [...] König Fußball die Republik in den Ausnahmezustand versetzen soll, beginnen wir das Turnier auf unsere Art und wecken auch das verschlafene Düsseldorf mit Bombenstimmung aus seinem Schönheitsschlaf!", hieß es zum Anlass der unter dem Motto „Das System ist der Fehler!“ stehenden Demonstration durch die Innenstadt. Der etwa 270-köpfige Aufmarsch nahm durch die Verwendung des Begriffs „Bombenstimmung“ in der Ankündigung deutlich Bezug auf den Wehrhahn-Anschlag. Unter den Teilnehmenden befanden sich auch diverse ehemalige Mitglieder der KSD.
Festzuhalten bleibt: Der damaligen extremen Rechten vor Ort, zu der auch Ralf S. gehörte, wäre ein rechtsterroristischer Anschlag wie der am S-Bahnhof Wehrhahn durchaus zuzutrauen gewesen, auch wenn damals keine konkreten Hinweise darauf bekannt waren, dass eine solche Option verfolgt wurde. Die zunehmende Radikalisierung und Organisierung der lokalen Neonazi-Szene, ihre auch überregionale Vernetzung mit erfahrenen militant-neonazistischen Strukturen und ihre u.a. über das „NIT Rheinland“ propagierte Feindbestimmung, zu der neben Linken und „Ausländern“ explizit auch Juden:Jüdinnen zählten, sprechen aber eine deutliche Sprache.
Bei dem Text handelt es sich um eine gekürzte Fassung eines Beitrags von Jürgen Peters in Sabine Reimann/Fabian Virchow (Hg.): "Und damit kam die Angst ..." Der rechtsterroristische Anschlag am S-Bahnhof Düsseldorf-Wehrhahn, Berlin 2025
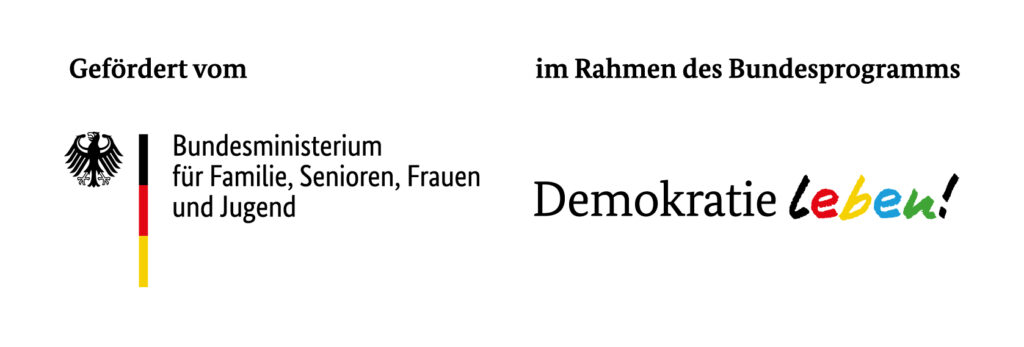

Mit freundlicher Unterstützung des Zweck e.V.